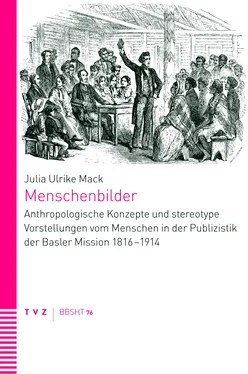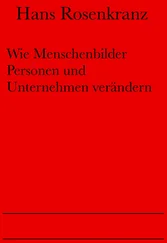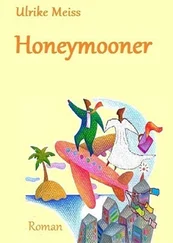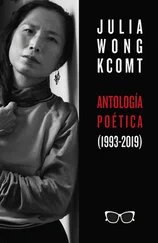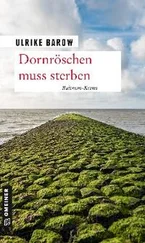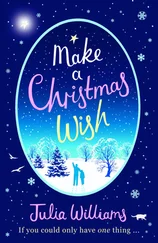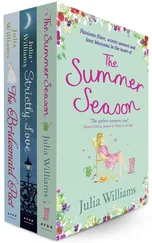Bei den Publikationen der konfessionellen Missionsgesellschaften bietet sich ein ähnliches Bild wie bei den überkonfessionellen: Alle gaben eine regelmäßige Veröffentlichung mit einem Überblick über die Arbeit und die Missionsgebiete |59| der Missionsgesellschaft heraus. Die jüngeren Missionsgesellschaften erkennt man am weniger ausdifferenzierten Angebot – so die Breklumer, die Neuendettelsauer und die Hermannsburger Mission mit jeweils einer eigenen Zeitschrift und dem Jahresbericht. Die Breklumer Gesellschaft gab dazu noch eine Zeitschrift für die Frauenmission heraus.
Zeitschriften über die Frauenmission waren bei den konfessionellen Missionsgesellschaften weniger stark und selbstverständlich vertreten und alle jüngeren Datums. Besonders fällt dies bei den Publikationen der Church Missionary Society auf, die eine breite Palette an Veröffentlichungen bot, aber bei der Frauenmission nur eine einzige Publikation herausgab, die angesichts der frühen Gründung der Church Missionary Society relativ spät (1893) erschien. Hier zeigt sich ein Unterschied zu den überkonfessionellen Missionen. Vor allem die Basler Mission und die London Missionary Society räumten schon früh – 1840 bzw. 1875 – der Frauenmission eine eigene Publikation ein.139 Die Berliner Missionsgesellschaft, die keine eigene Veröffentlichung zur Frauenmission herausgab, stand somit auf einer Linie mit den konfessionellen Missionsgesellschaften, zu denen sie ab 1865 zunehmend gehörte. Bei der reinen Menge an Publikationen fällt die Church Missionary Society deutlich aus dem Rahmen. Bei den überkonfessionellen Missionen hingegen ragt die Basler Missionsgesellschaft mit ihren Publikationen heraus. Dabei spielt die enge Verbindung, die Basel und die Church Missionary Society – trotz ihrer unterschiedlichen Ausrichtung in Fragen von Kirchlichkeit und Bekenntnis – bis in die 1850er Jahre pflegten, eine wesentliche Rolle.
3.2.3.3. ‹Radikale› bzw. Glaubensmissionen140
In Reaktion auf die zunehmende Institutionalisierung und Konfessionalisierung der älteren Missionsgesellschaften und der daraus resultierenden Einschränkung individueller Initiative versuchten die Glaubensmissionen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Unmittelbarkeit missionarischer Erweckung und eschatologischen Glaubenslebens vor dem ‹Erkalten› zu bewahren. Die Linie der überkonfessionellen Missionsgesellschaften wurde hier in radikalerer Weise fortgesetzt und eigenständig gedeutet. Eine Gemeinsamkeit bestand in der eschatologischen Motivation der Mission. Doch nun sollte die endzeitliche Gottesherrschaft durch Missionsengagement und -erfolge herbei gezwungen und vorweggenommen werden.141 Die Missionare zogen ohne Vorbildung und finanzielle Sicherheit, nur mit ihrem Glauben |60| und ihrem Enthusiasmus ausgerüstet, ins Missionsgebiet. Die Ausbildung sollte dann als learning by doing vor Ort geschehen. Nicht langwierige Bemühungen um einzelne Gemeindegründungen standen im Vordergrund, sondern die ‹Schnellevangelisation›.142 Die Vertreter der Glaubensmissionen waren davon überzeugt, dass auf diese Art und Weise der Missionsgedanke von allen unsachgemäßen Schranken befreit war.
Die Idee für eine so genannte ‹Glaubens›- oder ‹Freimission› war nicht neu. Schon in den älteren Missionen gab es Ansätze zu einer von organisatorischen und konfessionellen Begrenzungen losgelösten Missionsarbeit, deren Missionare sich und ihre Arbeit selbst finanzieren mussten. So wurde bereits 1835 der erste Basler Inspektor Blumhardt durch den englischen Freimissionar Anton Norris Groves zu einer unabhängigen und freien Missionstätigkeit nach dem Vorbild der Apostel angeregt und brachte eine Gruppe von Missionaren, angeführt von Hermann Mögling, dazu, ohne festen Lohn, unter Einhaltung des Zölibats und in apostolischer Genügsamkeit zu arbeiten. Nach Unruhe unter den anderen Missionaren sowie Bedenken von Seiten der Church Missionary Society und aus den eigenen Reihen gegen eine Mission ohne Anweisungen aus dem Heimatgebiet wurde von der Freimission wieder abgerückt.143 Auch Christian Friedrich Spittler und die Goßnersche Mission hatten diese Missionsrichtung vorbereitet.
Zum Vorbild für die späteren Glaubensmissionen wurde dann aber besonders Karl Gützlaff, missionarischer Einzelkämpfer in China. Seine Arbeitsmethode der Wanderpredigt und Schriftenverteilung durch chinesische Mitarbeiter wurde zunächst in Europa begeistert zur Kenntnis genommen. Sein Werk brach jedoch nach seinem Tod zusammen und nachdem Missstände in seinem Chinesischen Verein bekannt wurden, machte sich Ernüchterung breit. Seine langfristige Wirkung ist dennoch nicht zu unterschätzen: Gützlaffs Arbeit bereitete der Basler, der Rheinischen und der Berliner Mission den Weg nach China und war das Vorbild der Glaubensmissionen, allen voran der China Inland Mission (CIM).144 |61|
Die Goßner Mission und die Predigermission, welche sich von überkonfessionellen zu Glaubensmissionen entwickelten, zeigten es schon an: Von einer ‹Publikationsfreudigkeit› konnte bei den Glaubensmissionen keine Rede sein. Sie beschränkten sich meist auf eine Zeitschrift, in der sie von ihrer Arbeit berichteten und für die Sache der Mission warben. Immerhin gab die Allianz-Mission ihr Monatsblatt zusammen mit der Frauenhilfe der Allianz-Mission heraus und die Neukirchener Mission hatte eine Beilage für Kinder und Jugendliche in ihrem Missions- und Heidenboten.145
Die Beschränkung auf wenige Schriften war auch aus der Not geboren: Waren die Missionszeitschriften für alle Missionsgesellschaften ein anerkanntes Mittel zur Spendenbeschaffung, so hatten sie für die Glaubensmissionen eine noch existenziellere Bedeutung. Sie verzichteten ja bewusst auf eine organisatorische Absicherung in Form von Hilfsvereinen oder einer Notkasse, die im Fall eines finanziellen Engpasses einspringen konnten. Die Missionsarbeit war eine private Angelegenheit, und die benötigten Mittel sollten allein durch Gottes Hilfe, in Form von freiwilligen, nicht einkalkulierten Spenden zustande kommen. Die einzige Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und Spenden zu generieren, waren deshalb mündliche Vorträge und die Verbreitung von hauseigenen Zeitschriften und Traktaten, wie die Grundsätze der Waisen- und Missionsanstalt in Neukirchen zeigen: «Es giebt auch keine irgendwie organisierte Missionsgemeinde, an die wir uns halten können; aber wohl haben wie einen weiten Kreis zerstreuter Freunde und Freundinnen, meist Leser unseres Blattes, die treu für uns beten und in Gottes Hand das Werkzeug sind, daß uns immer wieder zur rechten Zeit das Nötige freiwillig zugeht. […] Grundsätzlich nehmen wir auch in unseren Ansprachen nur selten auf die Anstalten Bezug, da es uns anliegt, alles direkte Werben für die eigene Sache möglichst zu meiden».146 Hier wird der gnadenhafte, apostolisch-ursprüngliche Charakter der Missionsarbeit und des Missionserfolges unterstrichen. Die ‹zerstreuten Freunde und Freundinnen› bekamen den Eindruck, an einer sehr exklusiven, besonders frommen und ernsthaften Unternehmung teilzuhaben. Trotz aller Distanzierung von institutionalisierten Formen der Mission wurde so eine gemeinsame Identität gestiftet, die eine der wichtigen Voraussetzung für die Entstehung eines treuen Unterstützerkreises war. Obwohl die Verlautbarungen der Missionsleitung suggerieren wollten, dass für den Erhalt und den Erfolg der Glaubensmission allein die göttliche Gnade verantwortlich sei, fand doch eine Form von Institutionalisierung und Absicherung durch einen Unterstützerkreis statt. |62|
3.2.3.4. Kolonialmissionen
Ein Phänomen des späten 19. Jahrhunderts waren die Kolonialmissionen. Wie den deutschen Kolonialbestrebungen insgesamt, so war auch den daran anknüpfenden Missionsgesellschaften kein allzu großer Erfolg beschieden. Mit ihr erlebte der Typus der herrschaftsnahen Missionsgesellschaft eine Renaissance, sie gerieten durch ihre enge Verbindung zur Politik geradezu zur Karikatur einer solchen.147
Читать дальше