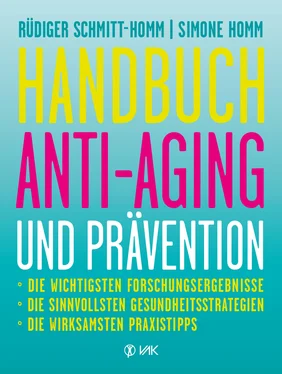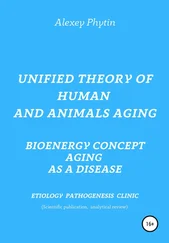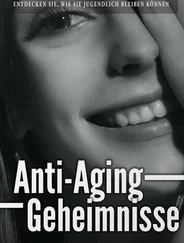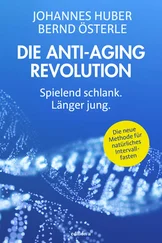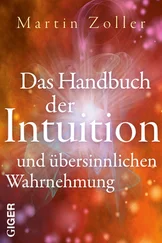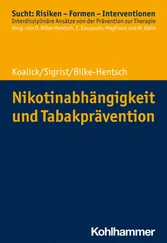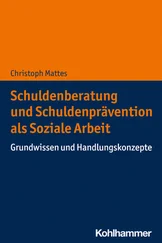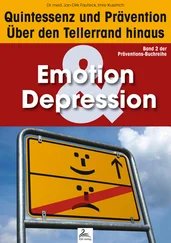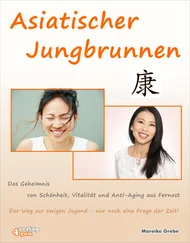Interessanterweise wird meist verschwiegen, dass die Königinnen durch die besondere Fütterung um ein Vielfaches schwerer werden als die anderen Bienen. Dieser Effekt soll natürlich möglichst nicht auf den Menschen übertragen werden. Unabhängig vom Aspekt Lebensverlängerung gibt es allerdings seriöse Hinweise auf gesundheitlich positive Effekte.
Mäuse haben nie Alzheimer
Es wäre schön, wenn kurzlebige Tiere immer einfach ein verkleinertes Modell der menschlichen Alterung wären. Leider ist dem nicht so. So laufen Nagetiere nicht Gefahr, typische menschliche Alterskrankheiten des Gehirns wie Parkinson oder Alzheimer zu erleiden. (Inzwischen gibt es allerdings genetisch gezielt veränderte Mäusestämme, bei denen sich Alzheimer imitieren und untersuchen lässt.) Krebserkrankungen hingegen lassen sich bei Mäusen und Ratten sehr gut untersuchen, weil die Tumorbildung dort recht vergleichbar mit der beim Menschen abläuft. Auch Nierenleiden sind bei Mäusen eine häufige Todesursache. Bei Fliegen wiederum, einem anderen wichtigen Forschungsobjekt in der Alternsbiologie, teilen sich die Zellen des erwachsenen Tieres nicht mehr. Entsprechend können sich bei ihnen keine Tumoren bilden.
Die Besonderheiten der verschiedenen Labortiere im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf den Menschen sind heute ein eigener Forschungszweig. Jedes Tiermodell kann uns also nur ganz bestimmte Antworten für unsere eigene Alterung geben. Wird das allerdings berücksichtigt, lassen sich diese einzelnen Mosaiksteine dann zu einem sehr genauen Gesamtbild zusammensetzen.
Länger leben heißt nicht automatisch: besser leben
Ein Punkt, der gelegentlich auch von Wissenschaftlern wenig beachtet wird, sind qualitative Aspekte. Ein Beispiel: Angenommen, es wird ein neues Mittel gegen das Altern getestet. Und tatsächlich verlängert es die durchschnittliche Lebensdauer von Versuchstieren um 30 Prozent. In der Regel geht jetzt jeder stillschweigend davon aus, dass die gewonnene Lebenszeit auch qualitativ eine gute ist. In den meisten Fällen ist das auch so. Um allerdings sicher gehen zu können, müssen in den Studienberichten Angaben zum Zustand der Tiere und zur endgültigen Todesursache enthalten sein. Viele Untersucher beschränken sich aber ausschließlich auf Zahlen und sparen mit qualitativen Beschreibungen. Der Grund ist nicht immer Nachlässigkeit. Als Forscher läuft man leider schnell Gefahr, unseriös zu wirken, wenn man etwa betont, dass die untersuchten Tiere trotz ihres Alters ein „glänzendes Fell“ hätten oder „auffallend munter“ seien.
Wir jedenfalls haben versucht, für den nachfolgenden Praxisteil diese und andere kritische Aspekte bei der Beurteilung der vielfältigen Zahlen und Daten zu berücksichtigen.
*
Mit den wesentlichen Grundlagen, die wir bis hierher kennengelernt haben, mit der Kenntnis der Fallstricke, vor allem aber mit dem Wissen um die Beeinflussbarkeit der menschlichen Alterung ausgerüstet, können wir uns nun dem wichtigsten Teil des Buches widmen, der gezielten Beeinflussung unserer Alterung.
II.
„Die sicherste Methode, ein hohes Lebensalter zu erreichen, ist die geschickte Auswahl der Eltern.”
CHRISTOPH WILHELM HUFELAND [deutscher Arzt und Begründer der Makrobiotik, 1762–1836]
An der Genetik scheiden sich die Geister. Die einen lehnen genetische Forschung als Eingriff in eine höhere Ordnung ab, andere sehen in diesem Gebiet einen Schlüssel, mit dem sich Krankheiten und auch das Altern besiegen lassen. Schon gibt es Stimmen, die angesichts der Fortschritte in der Grundlagenforschung zur Zellalterung bald eine Lebensspanne von 200 bis 300 Jahren beim Menschen für erreichbar halten. Starke Worte.
Weil dabei große Hoffnungen geweckt werden, möchten wir diesen Forschungsbereich nicht auslassen; auch wenn die Genetik kein Gebiet zu sein scheint, bei dem wir selbst aktiv werden können. Oder doch?
Menschliche Zellen erneuern sich nicht unbegrenzt
Bis vor 50 Jahren herrschte die Lehrmeinung, dass sich Zellen immer wieder teilen und damit erneuern und verjüngen können. Altern und Zelltod galten als eine Folge äußerer Einflüsse.
Entsprechend groß war der Schock, als in den 60er-Jahren ein damals unbekannter Forscher mit Namen Leonard Hayflick aufgrund von Tests behauptete, menschliche Zellen könnten sich nicht unendlich oft teilen, sondern nur in genau begrenzter Häufigkeit. Das Altern wäre somit nicht von äußeren Einflüssen oder einer übergeordneten Macht verursacht, sondern hätte seine festgelegten Ursachen im Erbmaterial der Zellen. Gibt es vielleicht sogar eine zentrale Altersuhr in unseren Genen, die das Leben irgendwann abschaltet? Wir wären jedenfalls nicht die einzigen Lebewesen, die so eine Steuerung besäßen.
Genetische Todesprogramme
Bei vielen Pflanzen und Tieren werden Altern und Tod sehr exakt von genetischen Programmen gesteuert – manchmal auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise: Pazifische Lachse etwa sterben kurz nach ihrer ersten und einzigen Eiablage und nachdem riesige Mengen ausgeschütteter Stresshormone eine rasend schnelle Alterung bewirkt haben. Innerhalb weniger Tage entstehen bei den Fischen atherosklerotische Veränderungen und ein altersschwaches Immunsystem. Tintenfischweibchen sind gesund und leistungsfähig, bis sie ihre Brutpflege für die Eier geleistet haben. Unmittelbar nach dem Schlüpfen ihrer Jungen beginnen sie plötzlich im Zeitraffer zu altern und sterben.
Auch Programme lassen sich überlisten
Wie man sieht, können Altern und Tod tatsächlich exakt genetisch gesteuert sein. Die Beispiele aus dem Tier- und Pflanzenreich zeigen gleichzeitig aber auch etwas anderes: Selbst scheinbar streng festgelegte genetische Alterungsprogramme sind variabel, ändern sich und können gezielt unterlaufen werden.
Agaven sterben normalerweise sofort nach dem Blühen ab. Wird der Blühvorgang aber verhindert, lassen sich die Pflanzen praktisch unbegrenzt am Leben halten. Bei unserem gerade erwähnten Tintenfisch genügt es, den erwachsenen Tieren ihre speziellen optischen Drüsen zu entfernen. Dadurch wird das Brutverhalten unterbrochen und die Tintenfische leben etwa dreimal länger als genetisch ursprünglich „vorgesehen“.
In den Genen kodierte Alternsprogramme sind also durchaus keine starren Abläufe, sie werden vielmehr von äußeren Faktoren mitbestimmt. Es ist deshalb möglich, in genetische Abläufe auf indirekte Weise einzugreifen – auch bei uns Menschen. Wie wir später noch sehen werden, ist das gar nicht so kompliziert, wie es das Thema Genetik vermuten lässt.
Suche nach den Todesgenen
Anstatt Alternsprogramme über Umwege zu unterlaufen, kann man den genetischen Code natürlich auch direkt verändern. Vorausgesetzt, man weiß wo. Bei einem Fadenwurm ist das inzwischen gelungen. Wissenschaftlich heißt das Tier Caenorhabditis elegans.
Dieser sehr kleine Wurm ist mittlerweile so gut untersucht, dass alle Gene identifiziert wurden, die für seine Alterung verantwortlich sind. Wissenschaftler konnten das Erbmaterial des Tieres bereits gezielt verändern. Resultate des Eingriffs waren eine verlangsamte Alterung und eine dreimal längere Lebensspanne. Unter anderem produzieren entsprechend genetisch veränderte Tiere größere Mengen von Antioxidantien. Sie sind also besser gegen schädliche Radikale geschützt. (Anmerkung: Radikale sind auch beim Menschen für das Altern mitverantwortlich. Im nächsten Kapitel werden wir uns ausführlich mit ihnen beschäftigen.)
Auf den Menschen übertragen würde das Beispiel des Fadenwurms eine mittlere Lebensdauer von 250 Jahren ergeben. Steckt auch bei uns ein Jungbrunnen in den Genen, wenn wir nur genau nachsehen? Wäre die Antwort ja, könnte sich die Suche allerdings hinziehen. Beim kleinen C. elegans hat die Entschlüsselung sämtlicher Codes viele Jahre gedauert. Dabei besteht sein gesamter Organismus aus gerade einmal 959 Zellen. Etwa ein Drittel davon sind Zellen des Nervensystems. Der Mensch dagegen besitzt schon allein im Nervensystem 10 12Zellen (das ist eine Zahl mit zwölf Nullen). An eine nicht nur theoretische Entschlüsselung der Gensequenzen, die gerade erst gelungen ist, sondern vor allem an eine praktische Nutzung ist dort in den nächsten Jahrzehnten nicht zu denken. Im Übrigen gibt es bisher überhaupt keine Vorstellung davon, wie eine konkrete Anwendung für den Einzelnen überhaupt umsetzbar wäre.
Читать дальше