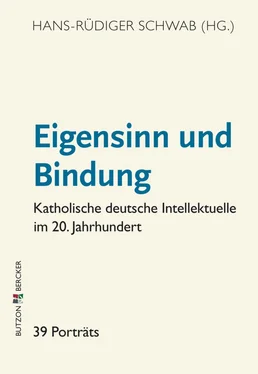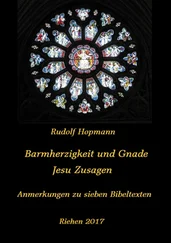Bernhart war ein Brückenbauer, ein Interpret und Übersetzer mit Empathie und Präzision, ein Theologe, der die biblische Botschaft ins Gespräch brachte mit im Katholizismus seiner Zeit gemiedenen oder verfemten Autoren wie Goethe und Nietzsche.
Die Suche nach dem Sinn der Geschichte
Der Seelsorger, Theologe und Historiker wurde angesichts der Trümmer zum Deuter der Geschichte, der zeitgeschichtlichen Ereignisse, ja der Geschichtlichkeit von Mensch und Schöpfung überhaupt. Bernharts Geschichtsverständnis wurde in „Tragik im Weltlauf“ in einem ersten Anlauf vorgelegt. In diesem Themenfeld bewegen ihn vorrangig die Fragen, wie man die dunklen Seiten des Geschichtsverlaufs aushalten kann, wie deren Sinnhaftigkeit durch das Stellen in eine höhere Ordnung aufzuweisen ist. Bernhart formuliert hier bereits 1917 sein Ringen um den Umgang mit dem zerbrochenen Sinn der Geschichte, die Trauer über Vernichtung und Trümmer, die die Ereignisse hinterlassen. Ihm ist deswegen vielfach Tragizismus unterstellt worden, ein Vorwurf, der nicht zu halten ist, wenn man den Ernst hört, mit dem Bernhart an vielen Stellen seiner Schriften die Bedeutung der ethischen Dimension in der Realisierung der christlichen Botschaft unterstreicht und gleichzeitig sein Ringen um die Klärung des Verhältnisses von Freiheit und Notwendigkeit, von Ewigkeit und Zeit kennt.
„Tragik im Weltlauf“, „Sinn der Geschichte“, „Chaos und Dämonie“ und dazwischen noch der Ruf des „De profundis“ sind zentrale Schriften. Bernhart hat ohne Zweifel ein sehr feinfühliges Sensorium für die Zeitfragen und die subkutanen Probleme der Zeitgenossen, leidet er doch selbst nicht nur an den Erwartungen seiner Eltern, an dem Unausgesprochenen in seiner Familie, an der vielfach sich äußernden Machtdemonstration seiner Kirche, an den Grausamkeiten der Ideologien. Wie ein roter Faden durchzieht die Konfrontation des reichen geistesgeschichtlichen Erbes in der Geschichtsphilosophie und Geschichtstheologie mit den abgründigen Erfahrungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts sein Werk.
In und nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges bezeichnete er zwar die Situation als eine, die die Menschheit sich selbst zum Rätsel mache, aber letztlich den Fragen der Theodizee keine neue hinzugefügt habe. Erschrecken bereite die Häufung des sittlichen und physischen Elends. Bernhart sieht eine Alternative, mit diesem Elend umzugehen, darin, dass der Mensch sich durch den Aufschwung in Illusionen rette. Er verurteilt diese Flucht nicht per se . Der Mensch könne sich aber auch, und diesem Lösungsweg gilt die Sympathie Bernharts, mit dem Mute wahrer Bildung dem Walten der Tragik im Weltgang nicht verschließen. 5Bernhart meint gerade nicht in eine Scheinwelt abzudriften, wenn er sich im Disput mit der Traditionslinie des Denkens des Tragischen befindet: mit Heraklit, Nikolaus von Kues, Johann Wolfgang Goethe, mit dem Prolog des Johannes-Evangeliums. Damit sind auch die Protagonisten angeführt: zum einen der menschliche Geist mit seinem Erkenntniswillen und der gleichzeitigen Einsicht in die Unzulänglichkeit eigener Erkenntnisfähigkeit im Gegenüber zur Wirklichkeit – und daraus resultierend die diskursive Struktur der Erkenntnis –, zum anderen der Logos , seinem Wesen nach ewig und deswegen tragisch in seinem zeitlichen Geschick unter den Menschen. Dreh- und Angelpunkt für die Schuldbewältigung ist nach Bernhart letztlich die Deutung des Christusgeheimnisses. Auf dieses Zentrum hin entfaltet er seine Antwort in diesem Bändchen: Es ist eine, die vorgegeben ist und ihren überzeugenden Ausdruck im Logos crucifixus findet, eine Antwort, die in ihrer tragischen Verfasstheit dem Duktus menschlichen Erkennens in den Bereichen von Geschichte, Natur, Mensch, Kultur und Kunst entspricht.
Konsequenterweise befasst Bernhart sich im letzten Kapitel von „Tragik im Weltlauf“ mit dem Logos crucifixus . Und das nicht zuletzt in einer zumindest subkutan mitschwingenden Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche. Er stellt dem Kapitel den Vers aus einem alten Passionsspiel voran: „Oh große Not, Gott selbst ist tot.“ Noch deutlicher wird diese Antwort aus dem Johannes-Evangelium formuliert. „Das Kreuz als Zeichen der äußeren Vernichtung ist zugleich das Zeichen der Erhaltung der höchsten Werte und der inneren Bewahrung geworden. Aber diese Erkenntnis war nicht die Sache der Vernunft, sondern der persönlichen Erfahrung im Anschluß an den tragischen Logos , den man in Jesus sah.“ 6Christus mit dem Kreuz erscheint als der Umwerter aller Werte.
„Tragik im Weltlauf“ ist eine Warnung vor dem zum Übermenschen stilisierten Menschen, vor der Erklärung oder Hinnahme der Welt mit rein innerweltlichen Kräften. Sie ist vielleicht weniger eine Warnung vor dem Ende der Metaphysik, wenngleich sie auch das ist, als vielmehr ein Versuch, zwischen Neuscholastik und Idealismus mit dem Logos des Evangeliums, mit Augustinus und der Mystik eine Zwischenposition zu finden, jenen Antwort zu geben, „die in der allgemeinen Erschütterung der Dinge die Frage nach den Fundamenten unseres Daseins stellen“.
Die bleibende Bedeutung der Kreuzestheologie, ihre Zentralität für Bernharts Beschäftigung mit der Theodizee, zeigt sich auch in dem Essay „Tragische Welt“ (in: „De profundis“), der sowohl als Warnung Bernharts vor einer Tragisierung Gottes zu sehen ist wie auch als ein Antwortversuch auf jene, die ihm mit dem Bändchen „Tragik im Weltlauf“ selbst Tragizismus vorgeworfen haben. In dieser Abhandlung über die tragische Welt findet sich als Korrelat zum Kreuz der Hinweis auf die Herrlichkeit des Auferstandenen, die freilich nicht ohne die Spuren des Kreuzes zu denken ist. Der Auferstandene behält seine verklärten Wunden: „Wir sind nicht von der Tragik der Welt erlöst , sondern hineinerlöst in ihre volle Gültigkeit vor Gott. Erst dann, wenn dies erkannt ist, fassen wir die Herrlichkeit des Auferstandenen. Er ist auferstanden, aber mit Wunden. Mit Wunden, aber mit verklärten.“ 7
Zeit und Ewigkeit: Der mystische Mensch
Theologie und Geschichtsdeutung sind zuinnerst charakterisiert durch Bernharts Blick auf den mystischen Menschen, der Ziel jeder seelsorgerischen Bemühung der Kirche sei. Eine beispielhafte Ausführung dieses Gedankens findet sich in dem nachgelassenen Fragment „Das Stehen des Heiligen in der Geschichte“, das wohl 1943 entstanden ist – etwa zeitgleich mit seinen Überlegungen zum „mystischen Menschen“. Bernhart präsentiert dort ein Verständnis von Geschichte, das sehr deutlich auf Thomas von Aquin verweist; seine Sammlung und Kommentierung von Texten aus der „Summa theologiae“ liegt erst wenige Jahre zurück. Es kommt eine Tendenz zur Metaphysik in die Argumentation, wenn er das letzte „Was“ der Geschichte in der Rückbewegung des Menschen zu seinem erhabenen, weil ewigen Seinsgrund liegen sieht.
Die Frage nach dem Austarieren von Zeit und Ewigkeit steht für ihn im Mittelpunkt, einer Ewigkeit, die das Zeitliche nicht aufsaugt, sondern vor ihr Gericht fordert. Das Zeithafte, jeder Augenblick wird mit einer ungeheuren Entscheidungsintensität aufgeladen. Jeder Augenblick menschlichen Lebens, der Kirche, der Geschichte wird im Blick der Ewigkeit zur Krisis. Weil aber Freiheit und Notwendigkeit zusammengedacht werden müssen, ist es nicht nur das Handeln des Menschen, sondern auch sein Schicksal, das die Geschichte prägt. Gottes stets schöpferisches Handeln – Bernhart legt großen Wert darauf, die creatio continua zu unterstreichen – und das des Menschen prägen den Lauf der Dinge. Eschatologie ist nicht nur im Sinne einer Teleologie ans Ende der Zeiten verlegt, sondern sie ist eine präsentische, die das menschliche Handeln in jedem Augenblick vor den göttlichen Endsinn aller geschöpflichen Wirklichkeit fordert: Die Allgegenwart Gottes auch in der Zeit ist zugleich die Allgegenwärtigkeit jeglicher Zeit und Geschichte vor Gott. 8
Читать дальше