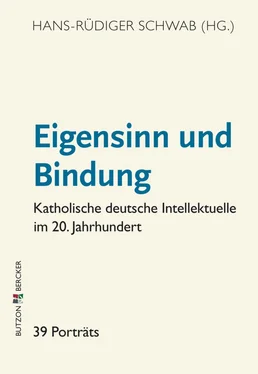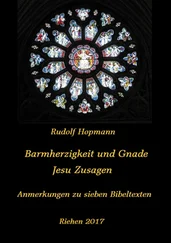Die Geschichte ist Urform menschlicher Existenz. Nur in der Geschichte kann der Mensch sich und die Welt erfahren und sein Leben meistern. Das ganze Wesen des Menschen ist unmittelbar mit der Geschichte verbunden, ja, sie ereignet sich in ihm selbst: „Es gibt keine Grenze zwischen Geschichtlichem und Subjektivem (...) Die Zeit ereignet sich in uns. Darum müssen wir sie als unsere eigenste Sache verantworten.“ 42In Verantwortung und Entscheidung gerufen, muss sich der Mensch mit seinem Leben in der Geschichte bewähren; nur so kann er zu sich und seinem eigenen, tiefsten Wesen vordringen: Er selbst muss die Zusammenhänge verantwortlich wählen und sie als Auftrag vollziehen. Dieses Muss ist der Kern der Person.
Sinn und Bedeutung der Geschichte erkennen Konrad Weiß und Reinhold Schneider darin, dass sich in ihr das Drama des menschgewordenen Gottes in der Welt vollzieht. Der Lebensweg Jesu verläuft nicht einfach in Übereinstimmung mit den Plausibilitäten der Gesellschaft und der Welt, doch steigt der Menschensohn aus der Welt und ihrer Geschichte nicht aus: Christus hat den Leib des Menschen angenommen, das heißt, er hat sich zur Geschichte entschlossen, selbst wenn er am Kreuz scheitern wird. Die Botschaft von jener Erlösung, die nicht von der Welt ausgegangen ist, scheitert in der Welt, aber die Welt scheitert auch an ihr. Dass die Geschichte nicht im Fragmentarischen tragisch scheitert, wird nur nachvollziehbar im Glauben an die Auferstehung:
„Denn so groß ist kein Mangel wie Gottes Ankunft ...“ 43
Schriften von Konrad Weiß: Gedichte 1914 – 1939. Hg. v. Friedhelm Kemp. München 1961 – Prosadichtungen. München 1948 – Tantum dic verbo. Gedichte. Leipzig 1919 – Zum geschichtlichen Gethsemane. Gesammelte Versuche. Mainz 1919 – Die cumäische Sybille. München 1921 – Die kleine Schöpfung. München 1926 – Das gegenwärtige Problem der Gotik. Mit Nachgedanken über das bürgerliche Kunstproblem. Augsburg 1927 – Die Löwin. Vier Begegnungen. Augsburg 1928 – Das Herz des Wortes. Gedichte. Augsburg 1929 – Tantalus. Augsburg 1929 – Der christliche Epimetheus. Berlin 1933 – Konradin von Hohenstaufen. Ein Trauerspiel. Leizig 1938 – Das Sinnreich der Erde. Gedichte. Leipzig 1939 – Deutschlands Morgenspiegel. Ein Reisebuch in zwei Teilen. 2 Bde. München 1950 – Das kaiserliche Liebesgespräch. München 1951 – Die eherne Schlange und andere kleine Prosa. Hg. v. Friedhelm Kemp. Marbach a. N. 1990.
Sekundärliteratur: Hanns-Peter Holl: Bild und Wort. Studien zu Konrad Weiß. Berlin 1979 – Friedhelm Kemp/Karl Neuwirth (Bearb.): Der Dichter Konrad Weiß, 1880 – 1940. Marbach a. N. 32001 – Carl Franz Müller: Konrad Weiß. Dichter und Denker des „Geschichtlichen Gethsemane“. Freiburg/Schweiz 1965 – Wilhelm Nyssen (Hg.): „... und ganz aus Echo lebend ist mein Leben“. Akademie zum 100. Geburtstag des Dichters Konrad Weiß (1880 – 1940). Köln 1983 – Michael Schneider: Konrad Weiß (1880 – 1940). Zum schöpfungs- und geschichtstheologischen Ansatz im Werk des schwäbischen Dichters. Köln 2007 – Ludo Verbeeck: Konrad Weiss. Weltbild und Dichtung. Tübingen 1970.
Joseph Bernhart (1881 – 1969)
Joseph Bernhart
Die Krisis menschlichen Handelns und der Geschichte
Rainer Bendel
„Man sagt, die wichtigsten Fragen seien die vergeblichsten, und meint, man sollte sie deshalb aufgeben. Sagen wir lieber umgekehrt, daß die vergeblichsten Fragen, wie die nach dem Menschen und nach Gott, die wichtigsten sind, was alsdann so zu verstehen wäre, daß es von unendlicher Wichtigkeit ist, nicht aufzuhören zu fragen, so wichtig wie die Unendlichkeit selbst, mit der wir uns der wahren Lebensluft beraubten, wenn sie unser Fragen, gerade unser vergebliches Fragen nicht mehr beschäftigte. Ist dieses Fragenmüssen ins Vergebliche nicht die großartigste, über alles menschenwürdige Antwort auf unser Fragen? Die docta ignorantia ist gelehrte, aber auch belehrte Unwissenheit.“ 1
Diese Notwendigkeit, Fragen zu stellen, macht den katholischen Intellektuellen Joseph Bernhart zum Wegweiser in eine neue Zeit, deren Signum das Finden neuer Paradigmen ist, die das Profil schärfen, die aber auch das Wissen um und die Intention zur Integration haben: Der Intellektuelle will sich einbringen in die wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Debatten, in die religiösen Suchbewegungen der Zeitgenossen. Er versucht Antworten aus dem reichen Fundus christlicher Traditionen und erschüttert mit seinen Fragen manche gesellschaftlichen und religiösen Fassaden und Zwänge. Er will damit die Menschen hinweisen auf den tieferen, den inneren, den größeren Zusammenhang: das Humanum , die Catholica . Der Intellektuelle erscheint hier als Prophet, als Kritiker, als Mahner, Deuter und Wegweiser in den Suchbewegungen, in den Umbrüchen und Aufbrüchen, in den Katastrophen des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts.
Die ersten Suchbewegungen des jungen Seelsorgers zielten auf Wege aus der ,kulturellen Inferiorität‘ der Katholiken im Bismarckreich; die partielle Ausgrenzung empfand Bernhart schmerzlich. Rückzug in das eigene Milieu, Ghettoisierung waren für ihn keine akzeptable Antwort. Aufbruch und Ausbruch, Anregung und Austausch suchte er in diesem Klima in erster Linie im Umfeld der Zeitschrift „Hochland“. Während seines Studiums der katholischen Theologie von 1900 bis 1904 in München hatte er diese Öffnung und Offenheit weitgehend vermisst. Allein der Rückgriff auf die pluriforme theologische Tradition in seinen dogmenhistorischen Studien und seiner eigenen Dissertation zu unterschiedlichen mystischen Ansätzen in der mittelalterlichen Theologie zeigten ihm dort einen Ausweg aus der neuscholastischen Ghettotheologie. Bedrückende Enge und Bespitzelung im eher intellektuellenfeindlichen Klima empfand er schmerzlich. Eine Antwort sah er allein im Ausbruch aus der kirchenamtlich verordneten Unzeitgemäßheit und damit verbundenen Inferiorität.
Als Bernhart 1910 auf dem Augsburger Katholikentag, aufgrund seiner Mitarbeit am „Hochland“ von einigen Bischöfen kritisch beäugt, über die „Bildungsaufgaben der Katholiken“ sprach, wollte er Letztere zu einem verstärkten Engagement auf allen Sektoren der Kulturarbeit anstacheln und so aus ihrer damaligen, zumindest von ihnen so wahrgenommenen Ghettosituation herausführen; gleichzeitig warnte er vor polemischer Haltung gegenüber modernen außerkirchlichen Richtungen in Wissenschaft und Kunst. „Das ganze Tagwerk unserer Zeit, stolz in seiner Mühsal, mag nur immer tiefer graben draußen in der Welt und drinnen in der Menschenbrust; wir vertrauen, das Ende kann nur dieses sein: Entdeckung Gottes in der Außenwelt, Allelujasang der Schöpfung, Kreuzauffindung in der Menschenseele.“ 2Gegen Verdächtigungen und Verurteilungen des Modernismus und Reformkatholizismus durch die Kirchenleitung vertrat der junge Theologe eine optimistische Position im Hinblick auf einen Dialog der Theologie mit den modernen Wissenschaften und der Kultur; er zeigte keine Berührungsängste, keinen Ghettogeist.
Mit allen Fasern seines Intellektes und Gemütes mühte Bernhart sich um das Gespräch von Theologie und modernen Wissenschaften, um die Zeitgenossenschaft von Kirche und moderner Kultur, um den Einsatz der Kirche in den drängenden sozialen Fragen und schließlich darum, die Erkenntnisse seiner Forschungen und Reflexionen zur Mystik auch für die Seelsorge fruchtbar zu machen. Der Theologe, „der mit so feiner Witterung auf den Fährten des modernen Denkens geht“, der um die Fähigkeit seiner Kirche zur Zeitgenossenschaft, damit zu einer Frucht bringenden Seelsorge rang, litt an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert daran, „daß wir im kirchlichen Leben am Ausgang des Mittelalters stehen“. 3Kein Wunder, dass er als Reformkatholik kritisch beäugt, zuweilen gar in die Nähe der so genannten Modernisten gerückt wurde.
Читать дальше