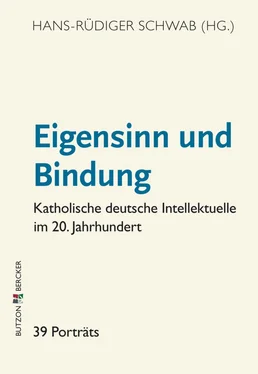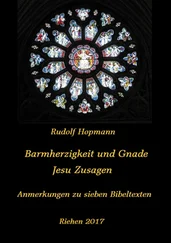Gegen die „Wut des Gehirns“ setzt Konrad Weiß den „Schuldkern von Menschen und Dingen“. Niemals wird es dem Menschen vergönnt sein, den metaphysischen „Mangel“ seines Daseins zu beheben. Dieser Ansatz zeigt sich für Konrad Weiß schon in der Studienzeit als einzig möglicher. Es ist nicht der Ansatz der Neuscholastik, die mit theologisch-philosophischem Begriffsgerüst den Zugang zu Welt und Glauben eröffnet, ohne jede zeitgeschichtliche Verortung aus einer neuen Erfahrung des Glaubens. So wendet sich Konrad Weiß entschieden gegen den „babylonischen Turm des bürgerlichen [ausgehenden 19.] Jahrhunderts, der heute einfällt“. Auch lehnt er den liberalen Idealismus ab, der für ihn nur eine politisch neutrale, human optimistische Spannungslosigkeit oder gar schriftstellerische Vergnügung darstellt. Konrad Weiß wendet sich auch gegen den zeitgenössischen Bildungskatholizismus nach Art Theodor Haeckers, der – nach seiner Meinung – die Sprache nur als ein formales Dienstmittel benutzt, dass das Christentum „nicht partnerisch gleich mit der rein und bloß positiven Gesellschaftsform Seite an Seite treten kann“. 12
Gegenüber den propagierten Idealen eines schöngeistigen Humanismus betont Konrad Weiß, dass die Wirklichkeit immer um eine „Träne“ verschieden ist von der „Idee“. Die Geschichte, in der die Menschheit mit ihrer ganzen Tragik steht, stellt keine Humanitätsform dar. Der Mensch kann den Glauben nicht in plausible Brauchbarkeit verwandeln, ihm bleibt nur ein Gehen wie durch Mangel. In der Nicht-Adäquation und Ungleichheit des „Dinges“, das sich in keine kategoriale Ordnung einreihen lässt, 13zeigt sich die Differenz aller „Dinge“ gegenüber jeder Verallgemeinerung. Alles, was der Mensch schafft, auch sein Werk und die Kunst, bleibt unvollkommen und verschieden von dem, was eigentlich zu sagen und auszudrücken ist:
„Die Kunst ist immer um ein tantum dic verbo verschieden von einer Vollkommenheit; dieser Schmerz ist zugleich das Glück ihrer Zeitform. Es ist in dieser Verschiedenheit des Gegebenen und des Sinnes die Spanne, worin die Geschichte ihren Platz hat und in ihr die menschliche Gesellschaft, von welcher die Kunst getragen wird.“ 14
Den Urgrund aller Wirklichkeit wird kein Wort und kein Kunstwerk erreichen; nur durch die Dinge und Bilder hindurch kann der Mensch ihn berühren, jedoch im Mangel und in der Entfernung, im Fragment und in der Gebrochenheit. Statt sich in natürliche bzw. rein ästhetische Schönheit zu verlieren, hat die Kunst die zeitmöglichen, wenn auch leidvollen Formen der Geschichte anzunehmen. Das Kunstwerk stellt eine einzelne Form in ihrer jeweiligen geschichtlichen bzw. zeitmöglichen Vergegenständlichung dar; solche Verwirklichung bleibt unvollendet und trägt den Makel irdischen Mangels an sich. Jedes Kunstwerk ist beladen mit der „Schwere der Zeit“.
Statt eines zeitlosen, abstrakten und damit, wie er es nennt, „toten“ Verstehens geht es Konrad Weiß um das „organische fruchtbare Gebundensein in Zeit und Geschichte“. 15Die Kraft des Christentums zeigt sich nicht in einem logischen, sondern in seinem organischen Verständnis der Geschichte, das im Hergang der Menschheit wächst. Seit der Menschwerdung Gottes muss jede erkennende Geistestätigkeit in die Form der Geschichte eintreten: „Durch das Christentum ist der Mensch als verantwortliche Seele aus der Masse herausgelöst worden; durch das Verlassenheitsgefühl des Erlösers ist die Seele individualisiert worden bis zur Verlassenheit.“ 16
Es kann wohl sein, dass der Einzelne zunächst den Eindruck hat, es genüge, sich in die natürlichen Ordnungen von Zeit und Ort einzuordnen, doch sobald er dem Anruf Christi begegnet, kann er diesen nicht mehr mit den rein logischen und allgemeinen Maßstäben beurteilen und beantworten, sondern wird in eine Entscheidung gerufen, die er selbst zu verantworten hat und hinter der er sich selbst nicht verstecken und aus ihr immer heraushalten kann. Christus schuf keine christliche Philosophie, wie auch das Christentum letztlich keine solche kreierte, vielmehr kann der Glaube nur in und als Geschichte verstanden und nur geschichtlich lebendig entfaltet werden: „Die Gesetze des Lebens sind nicht rein Begriff – nicht zeitlos, sondern mit Zeit gemischt, wie Treue.“ 17
Gegenüber dem „prometheischen“ Humanismus, der nach einem erdachten Weltbild zu handeln lehrt, wählt Konrad Weiß einen „epimetheischen“ Ansatz, um im Nachhinein zu bedenken, was ihm begegnet und zustößt, der eigenen Ohnmacht ausgeliefert angesichts des „Mysteriums der Geschichte, welche so wenig logisch ist wie das Mysterium iniquitatis“. 18Epimetheisch leben heißt nachsinnen über das, was schon vorher da war und ist. Prometheisch hingegen ist der Versuch des Menschen, sich selber als autonomes Maß und Sinnziel der Welt zu erfassen. Menschliches Leben bleibt „irdische Existenz“ und damit unvollendet und „unheil“, „beladen“ mit der „Last der Geschichte“, fern von jedem „Vollbracht“:
„Unseres Daseins Zwang und Art
ist stets rätselhaft und hart.“ 19
Der Mensch ist nicht „reiner“ Geist, sondern eingebunden in Volk, Familie, Land, Ort und Zeit. Geschichte ereignet sich als geschichtliche Verwirklichung des Einzelnen im Zeitlichen, doch im Verweis auf die letzte Erfüllung aller Geschichte.
Aus diesem Geschichtsverständnis ergibt sich eine tiefere Sicht des Glaubenslebens. Konrad Weiß kennt kein rein „geistliches Leben“, verstanden als Absolvieren von geistlichen Übungen und Pflichten oder als Erklimmen einer Vollkommenheitsleiter, indem der Mensch sich, seine Schwachheit und Mühsal letztlich zu überwinden trachtet in eine traute, weltenthobene Gottinnigkeit, vielmehr muss er erfahren, wie „stets rätselhaft und hart“ 20alles bleibt. So wird der Mensch
„versucht sein rennend um
die Spanne der Barmherzigkeit“. 21
Alles im Leben und Glauben ist nicht Sache der Theorie, des Verstehens und der objektiven Einholung, vielmehr muss alles existenziell erbracht werden, auf „daß Erfahrungen mit Vitalitäten bezahlt werden müssen und darum keiner dem andern gleich erfährt, keiner den andern ein- oder überholt, außer wie es ihm gegeben, diese Abgeschlossenheit des einen gegen den anderen, diese Beschlossenheit und geführte, abhängige Freiheit ...“ 22Seit dem Kommen des Menschensohnes kann jedes Geschehen in der Zeit eine tiefere Bedeutung in sich tragen und Symbol eines tieferen Sinnes sein: Nichts genügt sich selbst, sondern sucht seine letzte Erklärung durch seine Teilhabe am Kommen des Menschensohnes.
Gott ist kein Begriff und Christus kein Gattungsbegriff, alles ist einmalig und absolut frei und geht ein in die je einmalige geschichtliche Vollzugsgestalt menschlicher Freiheit und Antwort. Die Vorstellung einer „Geschichte im Symbol“ bzw. vom Symbolgehalt des Daseins ist auch für Georges Bernanos, Reinhold Schneider, Erich Przywara und Hans Urs von Balthasar bestimmend. Für sie alle gilt: „Die Geschichte ist zwar nicht das Letzte, um das es geht; aber es geht um das Letzte nur in der Geschichte.“ 23
So sind für Konrad Weiß die Ideen ersetzt durch das eingeborene Wort. An die Stelle der Idee tritt das Inbild, das allem einwohnt und alles zu einem Symbol macht: „Durch die Menschwerdung wurde das Vorbild zum Inbild, die Idee aus dem kosmischen Bild der Menschheit in das Wort der Einzelnatur gelegt.“ 24
Die Natur ist keine eigengesetzliche Macht, sondern Schöpfung Gottes, doch in Geschichte durchkreuzt. Die Welt, im Logos geschaffen, wurde auf den Erlösungsplan hin entworfen, um im Menschgewordenen und Gekreuzigten ihren tiefsten Gehalt geoffenbart zu empfangen. So harrt die Schöpfung auf die Enthüllung der Söhne Gottes, um erkannt und gesagt zu werden.
Читать дальше