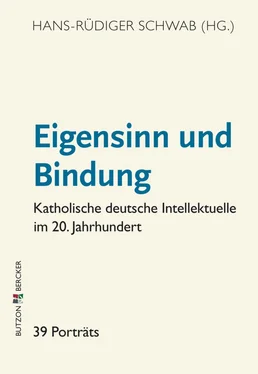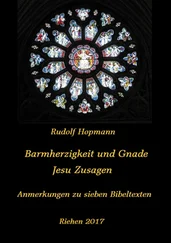Gibt es in Bernharts Theologie, in seiner Biographie Hinweise für eine Erklärung seiner vielschichtig dem Mainstream gegenläufigen Positionen? Den Mainstream hat Thomas Ruster in seiner Arbeit über katholische Theologen in der Weimarer Republik 13so charakterisiert: Nach dem Ersten Weltkrieg sei der Katholizismus in Deutschland auf eine Gesellschaft getroffen, die sich geradezu ruckartig modernisierte. Diese Transformation habe katholische Theologie tiefgreifend geprägt. Die Auseinandersetzung mit der modernen Welt sei überall dort prägend geworden, wo Theologen über den engeren fachwissenschaftlichen Diskurs hinausgingen. Ruster konstatiert ein breites Spektrum von Deutungsversuchen und Lösungsansätzen. Alle aber seien sie geprägt von der konstanten Grundfrage nach der Nützlichkeit der katholischen Religion in den veränderten Zeitumständen. Die Absicht, die eigenen Anliegen in der Transformation plausibel zu machen, barg die deutliche Gefahr der Adaptation in sich. Es ist bei Bernhart nicht zu vermuten, dass er sich den Veränderungs- und Auflösungsprozessen einfach nur widersetzte. Auch aus eigener biographischer Betroffenheit durch eine starre Praxis überkommener Vorschriften setzte er sich mit der jeweils neuen Situation und ihren Impulsen und Intentionen intensiv auseinander. Dabei wollte er den Katholizismus oder die Katholiken nicht funktionalisieren.
Woher nährte sich Bernharts Resistenz gegen den NS-Totalitarismus? War es seine konservative Grundhaltung, die ihn das pöbelhaft Revolutionäre des Nationalsozialismus abstoßend erscheinen ließ, wie Lorenz Wachinger vermutet, also ein restaurativer Widerstand? Die Erklärung greift zu kurz, hat Bernhart doch nicht nur 1918/19, sondern ebenfalls in dem angeführten Zitat von 1945 auch Sympathien für den „Linkskatholizismus“ erkennen lassen. Verankert in der Moderne und vertraut mit vielen Positionen der Geistesgeschichte der Neuzeit, mit Literatur und Kunst, leitet ihn sein Interesse für den Einzelnen.
Hauptsächlich die mystische Tradition der Theologie des Mittelalters faszinierte Bernhart und gab ihm vielfältige Impulse für seine eigenen Ansätze und Positionen, vor allem in der Hochschätzung des einzelnen Gläubigen und seines Gewissens wie auch in der Frage nach dem Austarieren von Zeit und Ewigkeit: der Ewigkeit, die das Zeitliche nicht aufsaugt, sondern jeden Augenblick zur Krisis werden lässt.
Bernharts Frage nach dem Sinn der Geschichte bringt ihn zu der nach den Bedingungen des Menschseins, seiner „Zwiemöglichkeit“ und der Verantwortung durch die Gabe des Gewissens. Die Würde des Einzelnen wird enorm aufgewertet. Die Gemeinschaft steht im Dienst des Einzelnen, nicht umgekehrt: Gegen die Hypostasierung der Gemeinschaft muss er aufstehen. Überhaupt wird Bernhart zunehmend skeptisch gegenüber abstrahierten Größen wie „Reich“ oder „Leben“.
Bei ihm wird die christliche Botschaft selbst zur Krisis, zur prophetischen Scheidung der Geister – damit wendet er sich gegen jede Funktionalisierung. Die Bergpredigt ist für Bernhart das Zentrum; er hatte die protestantische Bibelkritik seiner Zeit rezipiert. An den Propheten nimmt er Maß. So konnte bei ihm keine Begeisterung für den „Führer des Volkes“ aufkommen. „In der folgenden Zeit der Restauration und Reformation, des Festefeierns und des immer höher schwellenden religiös-nationalen Fanatismus lässt sich ein tief und weitaus schauender Mann wie Jeremias nicht beirren, ein Führer seines Volkes gegen dieses Volk zu sein. Von ihm und seinen Heilspropheten verhöhnt, verspottet, von seinen Nächsten verfolgt und am Leben bedroht, ein verzweifelnder Patriot in schauerlicher Einsamkeit, schleudert er aus der Qual eines heißen Herzens den Auftrag seines Gottes gegen Stadt und Staat und Tempel. Jahwes Wort haben sie verworfen: was für Weisheit ist ihnen geblieben? (...) Den Schaden meiner Volksgenossen möchten sie auf schnellfertige Weise heilen, indem sie rufen: Heil! Heil!, wo doch kein Heil ist. Schämen werden sie sich müssen, dass sie Greuel verübt haben. Aber für sie gibt es kein Erröten mehr, noch wissen sie mehr, was sich schämen heißt (...). Israel verwarf diesen bittern Führer, es folgte seinen Heilspropheten in das Unheil, das Babylon, wie Jeremias es vorausgesagt, an ihm erfüllte.“ 14
Bereits in der Frühphase des Dritten Reiches wurde Bernhart in der Verteidigung des Alten Testamentes mit dieser alttestamentlich-prophetischen Vision zu einem unbestechlichen, ja visionären Mahner seiner Zeit, der in seiner geistigen Distanz, gewonnen aus der profunden Kenntnis der reichen Traditionen europäischer Geistesgeschichte, nie in der Gefahr stand, sich anzubiedern, und dessen Gesichte sich so schrecklich erfüllen sollten.
Der katholische Intellektuelle nach Auschwitz
Wie versuchte Bernhart auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen und dem seiner theologischen Erkenntnisse die in Nationalsozialismus und Krieg angehäufte Schuld der Menschen, vor allem der Deutschen, zu erklären? Bereits 1944 konzipierte er dazu drei Reden: „Geschichtstheologischer Vortrag“, „Geheimnis der Bosheit“ und „Die Frohbotschaft vom Kreuz“. Bernhart spricht dort von der Unvergleichlichkeit der Entwicklung, von Finsternissen von einer solchen Intensität, wie es sie seit Menschengedenken noch nicht gegeben habe. Zusammengefasst und verdichtet sind diese Überlegungen in dem 1950 erschienenen Bändchen „Chaos und Dämonie“, das die unterschiedlichen Themenfelder Bernharts wie in einem Brennglas bündelt, die Wucht der Fragen der Zeitgeschichte aufnimmt und im Dialog mit zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen interpretiert. In diesem Kontext wählt Bernhart nicht mehr den Begriff der Tragik zur Umschreibung des gott-menschlichen Miteinanders, des Mit- und Nebeneinanders von Ewigkeit und Zeit. Er ist vom Ansatzpunkt her noch stärker schöpfungsorientiert und wählt wohl nicht zuletzt aus dieser Perspektive die Begriffe „Chaos“ und „Dämonie“ zur Beschreibung der Schöpfungswirklichkeit.
Die einleitenden umfänglichen Reflexionen weisen zudem darauf hin, dass er, dessen Sprache von der Kondensierung der Gedanken in zahlreiche Substantivierungen geprägt war, stärker auf die prädikative Ebene wechselt. Die neue Priorität zeigt sich schon in der Übersetzung der „Theologischen Summe“ des Thomas von Aquin (1934 ff.). Auch hier wurde die einengende und festgefahrene Terminologie der Substantive semantisch aufgesprengt und damit letztlich ein Beitrag zur Öffnung scholastischer Selbstverständlichkeiten geleistet.
Der Blick auf die Geschichte des Christentums, insbesondere auf die Erfahrungen der Schrecken des 20. Jahrhunderts bewegt ihn zu einer sehr kritischen Position: Aus tiefer Betroffenheit stellt Bernhart das Unvergleichliche der Schrecken des Dritten Reiches heraus. Sein Denkansatz lässt ihn aber mit einer nur moralischen Kritik von Kirche und Christen, dem bei vielen zeitgenössischen Theologen so geläufigen Argument eines Abfalls vom Christentum oder einer praktischen Lauheit nicht zufrieden sein. Dass es zu diesem Versagen kommen konnte, hängt – und darin wird die Traditionslinie seines Denkens deutlich – mit der Grundstruktur der Schöpfung zusammen, die eine antagonistische, eine dämonische ist – im ständigen Kampf zwischen der Tendenz zum Nichts und derjenigen zum Vollkommensein. Nach Christus hat dieser Antagonismus nicht an Spannung verloren, sondern neue Extrema gewonnen – insofern steht Bernhart hier durchaus in einer Nähe zu apokalyptischem Denken. Die dadurch verschärfte Theodizee-Frage verweist den Menschen auf die Ambivalenz seiner Freiheit, die in einem geheimnisvollen Zusammenwirken mit Gottes Willen steht. Der Mensch ist nicht nur eine Episode in der Geschichte, sondern der Tragende und Getragene einer höheren Geschichte. Nicht die Erkenntnisebene abstrahiert und überhebt den Menschen über den Fluss der Dinge und Geschehnisse, sondern das Gewissen, das nur theologisch begründbar ist. Dieser Mensch mit seinem Gewissen aber ist wie die Natur ein dämonischer, mit „Zwiemöglichkeit“ geladen, wobei „dämonisch“ nicht per se etwas Böses meint, sondern gemäß dem griechischen Ursprung etwas Ungeschiedenes und Unentschiedenes, das also jenseits von Gut und Böse liegt. Es ist potenziell fähig zu beidem. Damit stehen menschliches Handeln und Geschichte immer in der Krisis.
Читать дальше