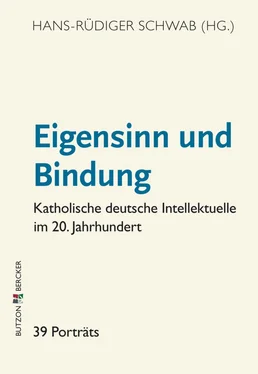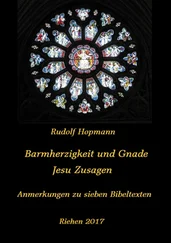So erscheint ihr die Lesung der Messe an „einem ganz nah an die Chorschranke gerückten Tisch (...) angesichts der Versammelten“ (SB 156) einmal als „ein schwerer Verstoß“ (SB 157), weil er die „Würde“ des zelebrierenden Priesters, seine „Distanz zur (...) Menge“ (SB 156) und seine „innere Sammlung“ zu beeinträchtigen vermag (SB 157). Als „zweiten Pol“ beschreibt sie jedoch wenige Seiten später eine Messe in der Pariser Saint-Séverin-Kirche, wo „der Menge zugewandt“ zelebriert wird, ohne dass ein „Entgegenkommen“, gar „Herablassung dem Volke“ gegenüber stattfindet, das ja erhoben werden wolle. Diese Menge – „vorwiegend Proletariat“ übrigens – ist ihrerseits „geschult“ und „dem Alltag entzogen“. Als „eine lebendige Saint Chapelle (...) reagiert sie mit der Geschlossenheit eines Orchesters“ (SB 164 f.). Vorbildliche Form besteht hier also in der aktiven Mitfeier. Mit einer tendenziell Hierarchie-zentrierten Ekklesiologie und Gesellschaftslehre hat Annette Kolbs monitum zugunsten des gewachsenen Ritus jedenfalls nichts zu tun. Immer geht es ihr um eine Haltung dem Mysterium gegenüber, das sich in der Messe bekundet.
Tradition und Erneuerung bleiben dabei aufeinander bezogen. Wahrhaft schlimm nämlich ist „die Trennung zwischen Kirche und Kunst“ (SB 165). Kitsch, wie er die Gotteshäuser seit dem 19. Jahrhundert verunstaltet habe, sei der größte Feind des Religiösen. So setzt sie Hoffnungen in Strawinskys 1948 uraufgeführte Messe und empfiehlt Marie-Alain Couturier OP, den (ihr auch persönlich bekannten) Pionier der Einbeziehung moderner Kunst in die Kirche, der die Sakralbauten von Le Corbusier ermöglichte und bei seinen Projekten herausragende Künstler wie Léger, Braque, Rouault, Chagall und andere zur Mitwirkung gewann, als Vorbild für die „Notwendigkeit eines neuen Baustils“ (SB 160) – wobei übrigens just das von Annette Kolb so gerühmte Beispiel der Kapelle in Vence dem Heiligen Offizium nicht unbedingt gefiel. 30
Im gleichen Kontext wird plötzlich noch ein anderer Ordensmann gepriesen, der Protagonist eines sozialen Katholizismus ist: Abbé Pierre, Gründer der Organisation „Emmaus“, besonders seiner Hilfsappelle für die Obdachlosen im Kältewinter 1953/54 wegen, als viele Menschen starben. Eine von Annette Kolbs Messfrömmigkeit offensichtlich untrennbare Dimension scheint hier auf.
Anfang August 1960 nimmt die Autorin am Eucharistischen Weltkongress in München teil. Auch hier macht sich ein spätzeitliches Bewusstsein geltend: „Wird vielleicht morgen das Ereignis vertuscht und vergessen werden? Über alle Wirrsal hinaus war es das Präludium einer besseren, schöneren und anderen Welt. War es der Inbegriff jener Abschiedsworte: ,Ich komme bald‘?“ (Z 206) Im Zusammenhang mit diesem Vers aus dem Buch der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament heißt es an anderer Stelle: „Wir glauben, wir halten unseren Glauben aufrecht, er ist nicht leicht, wir geben ihn nicht preis.“ 31
Am Ufer des Sees Genezareth
Bei aller wachsenden In-sich-Gekehrtheit im Alter verbindet sich mit Annette Kolbs letzten Lebensjahren eine wichtige Aktivität: der Höhepunkt ihrer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem „jüdischen Problem“ (F 67), das sie wiederholt „ein christliches“ genannt hat. Gerade weil sie dabei zuweilen nicht frei von Vorurteilen oder ambivalenten Bemerkungen ist, 32muss ihre spätere Haltung desto höher eingeschätzt werden.
In der 1934 noch in Berlin erschienenen „Schaukel“ ist im Zusammenhang mit einer Dame und dem für ihre Herkunft typischen „Qualitätsgefühl“ eine Anmerkung beigegeben: „wir sind heute in Deutschland eine kleine Schar [!] von Christen, die sich ihrer Dankesschuld dem Judentum gegenüber bewußt bleibt“ (S 135). Um das Erscheinen des Romans weiter zu gewährleisten, musste die Fußnote im Einvernehmen mit der Autorin ab der zweiten Auflage gestrichen werden.
Der Essay „Gelobtes Land – Gelobte Länder“ ist 1951 zunächst im „Hochland“ erschienen. Anhand persönlicher Begegnungen verfolgt Annette Kolb hier ihr jüdisches Interesse seit der Kindheit zurück. Frühere Vorstellungen vom Aufgehen der Juden in der deutschen Gesellschaft werden nun kritisch bewertet: „so war unsere Philosemitie eine antisemitische Sache“ (SB 133). Auch im Exil bleibt es bei „Sympathie, Parteinahme, Solidarität“ für die Juden, innerhalb derer sie freilich Unterscheidungen des geistigen Ranges vornimmt. Die „Unabhängigkeitserklärung eines jüdischen Staates“ am 14. Mai 1948 (die sie in ihrem Buch „Glückliche Reise“ acht Jahre zuvor hypothetisch antizipiert hatte) sieht sie als „Heimkehr (...) für einen so schwer geprüften Stamm“, welche „die gesamte Christenheit (...) ihm gönnte“, mit „Freude“ sogar (SB 148): „Wenn ihr aber meint, es habe eine höhere Fügung über eurer Heimkehr gewaltet, so sind auch wir dieses Glaubens.“ (SB 150)
Anfang 1963 lernt Annette Kolb den jungen jüdischen Autor Elazar Benyoëtz kennen. Rasch entwickelt sich eine Freundschaft. Sie schreibt ihm als seine „christliche Schwester“, 33er wird nach ihrem Tod das erste Buch über sie veröffentlichen („Annette Kolb und Israel“, 1970). Mit Blick auf den „letzten“ und „sehnlichsten Wunsch“ ihres Lebens 34schmiedet Annette Kolb Pläne, das Heilige Land zu sehen. 1967 tritt die 97-Jährige diese ihr so wichtige Reise an. Sie besucht das vermeintliche Grab des Königs David am Berg Zion, steht lange allein am Ufer des Sees Genezareth. „Dein Land“, lautet viereinhalb Monate vor ihrem Tod der letzte Satz in ihrem letzten Brief an Elazar Benyoëtz, es „ist schon mein Land geworden!!“ 35Und sie setzt zwei Ausrufezeichen dahinter.
Schriften von Annette Kolb: Kurze Aufsätze. München 1899 – Sieben Studien. L’ âme aux deux patries. München 1906 – (Hg.:) Die Briefe der heiligen Catarina von Siena. Leipzig 1906 – (Übers., zus. m. Franz Blei:) Gilbert Keith Chesterton: Orthodoxie. München 1909 – Das Exemplar. Roman. Berlin 1913 – Wege und Umwege. Leipzig 1914 – Briefe einer Deutsch-Französin. Berlin 1916 – Die Last. Zürich 1918 – Zarastro. Westliche Tage. Berlin 1921 – Wera Njedin. Erzählungen und Skizzen. Berlin 1925 – Spitzbögen. Berlin 1925 – Daphne Herbst. Roman. Berlin 1928 – Versuch über Briand. Berlin 1929 – Kleine Fanfare. Berlin 1930 – Beschwerdebuch. Berlin 1932 – Die Schaukel. Roman. Berlin 1934 – Festspieltage in Salzburg und Abschied von Österreich. Amsterdam 1938 – Mozart. Wien 1937 – Glückliche Reise. Stockholm 1940 – Franz Schubert. Sein Leben. Stockholm 1941 – König Ludwig II. von Bayern und Richard Wagner. Amsterdam 1947 – Blätter in den Wind. Frankfurt a. M. 1954 – (Übers.:) Valéry Larbaud: Sankt Hieronymus, Schutzpatron der Übersetzer. München 1956 – Memento. Frankfurt a. M. 1960 – 1907 – 1964. Zeitbilder. Frankfurt a. M. 1964 – Annette Kolb/René Schickele: Briefe im Exil 1933 – 1940. In Zus.arb. m. Heidemarie Gruppe hrsg. v. Hans Bender. Mainz 1987 – La vraie patrie, c’est la lumière. Correspondance entre Annette Kolb et Romain Rolland (1915 – 1936). Documents réunis par Anne-Marie Saint-Gille. Bern u. a. 1994.
Nachlassverzeichnis und Bibliographie in: Richard Lemp: Annette Kolb. Leben und Werk. Mainz 1970, 33 – 67 u. 114 – 117.
Sekundärliteratur: Sigrid Bauschinger (Hg.): Ich habe etwas zu sagen. Annette Kolb. 1870 – 1967. Ausstellung der Münchener Stadtbibliothek. München 1993 – Annette Bühler-Dietrich: Das entpersönlichte Antlitz des Abtes. Religiosität, Ästhetik und Geschlecht bei Annette Kolb. In: Ruth Albrecht/dies./Florentine Strzelczyk (Hg.): Glaube und Geschlecht. Fromme Frauen – Spirituelle Erfahrungen – Religiöse Traditionen. Köln/Weimar/Wien 2008, 80 – 98 – Jutta Kayser: Tochter zweier Vaterländer – Tochter der Kirche. Zum Leben und Denken von Annette Kolb. In: Internationale katholische Zeitschrift „Communio“ 24 (1995), 259 – 274 – Charlotte Marlo Werner: Annette Kolb. Eine literarische Stimme Europas. Königstein/Ts. 2000 – Doris Rauenhorst: Annette Kolb. Ihr Leben und ihr Werk. Freiburg/Schweiz 1969 – Jürgen Schwalm: „Ich mußte es auf meine Weise sagen“. Annette Kolb (1870 – 1967). Leben und Werk. Bad Schwartau 2006 – Armin Strohmeyr: Annette Kolb. Dichterin zwischen den Völkern. München 2002.
Читать дальше