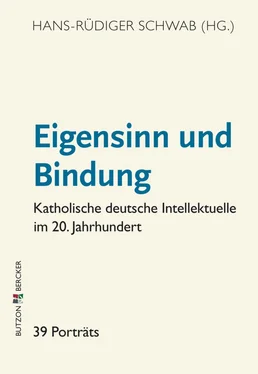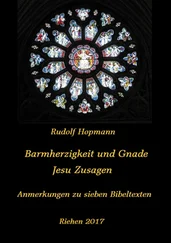Für Annette Kolb nimmt Caterinas „Mystik“ von Gott ihren Ausgang, „deren Ziel“ sei jedoch „die Menschheit“ (F 128). In diesem Zusammenhang wird das Jesuswort aus Joh 10, 34 von der Autorin mit einer besonderen anthropologisch-evolutionären Bedeutung aufgeladen: „Ihr seid Götter!“ (F 129) Noch anderswo kehrt es in ihren Arbeiten wieder. Sie sieht darin eine über den Menschen und seine individuellen wie geschichtlichen Entwicklungsmöglichkeiten kraft seines Ursprungs und der „Anrede“ 20Gottes ausgesprochene Verheißung.
Einen weiteren Anknüpfungspunkt für die Gegenwart arbeitet Annette Kolb bei Caterina heraus: Sie „wäre uns heute so stumm wie viele ihrer heiligen Genossen, die im Kalender stehen, wäre sie nicht als Frau so unvergänglich – modern bis in die Fingerspitzen –, als ,Frauenrechtlerin‘ vielleicht die einzige, die ganz unserem Geschmack entspricht“, was sich etwa darin zeige, „wie sie (...) mit aller Konvention bricht“ (F 129). In der Theologie werden solche Aspekte bekanntlich erst in ferner Zukunft aufgenommen.
Ein Jahrzehnt später beruft sich Annette Kolb auf eine andere Charakterisierung Caterinas aus dem Essay. Ihre „Briefe einer Deutsch-Französin“ (1916) verweisen auf die Aktualität der dezidiert politischen Heiligen als „Friedensstifterin“ (F 120). Selbst eine „Arbeiterin im Weinberg des Herrn“, wie man sie, analog zu ihrer Bezeichnung für Alfred H. Fried, den Gründer der Zeitschrift „Friedenswarte“, bezeichnen könnte, der „eigentlichen Seele der pazifistischen Bewegung in Zentraleuropa“ (F 162 f.), weigert sich Annette Kolb nicht nur, an der allgemeinen „geistigen Mobilmachung“ 21mitzutun, sondern engagiert sich gegen deren Ziele und die Realitäten des Krieges.
Erneut greift sie hier den Fortschrittsgedanken auf, hinter den die Menschheit nun aber zurückfällt. Angesichts ihres Entwicklungsstands sei der Krieg eigentlich ein Relikt „aus der Rumpelkammer“ der Gattung (SB 27). Unter Verweis auf die kulturschöpferischen Kräfte des Menschen widerspricht Annette Kolb einem Biologismus, der Kriege als naturgegeben, ja -notwendig bejaht. Auch wenn im Zeichen des Christentums selbst „die wüstesten Greuel in der Welt entbrannt“ seien, sieht sie in diesem die große Gegenkraft zum Krieg und geißelt die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Praxis bei den europäischen Mächten. Annette Kolb fordert die Regierungen auf, sie mögen „eine Doktrin, von welcher nicht die allerleiseste Notiz genommen wird, nicht mit so fluchwürdiger Stirn der Form nach noch aufrecht halten“. 22Allein das auf Vermittlung ausgerichtete Handeln Papst Benedikts XV., der sich zwischen den Fronten erfolglos um Friedensinitiativen bemüht, habe „das Recht auf seiner Seite“ (DF 96).
Trotz des Atavismus, den die „Kriegspsychose“ (SP 110) darstellt, hält Annette Kolb am Entwicklungsgedanken fest, dessen Ziel die Mitte des Christentums bezeichne. Nur ist der (für sie bezeichnenderweise „nach vielen Dezennien eines ausschließlichen Männerregiments“ ausgebrochene [DF 88]) Krieg ein Zeichen dafür, dass „die Menschheit“ zu „langsam und in so verzweifelt weiten Kurven um dies Gestirn“ evoluiere: „Aber der Gewalt des Christentums tut die menschliche Hinfälligkeit keinen Abbruch“ (DF 85). Bisher sei die Menschheit für die in ihm beschlossene Idee noch nicht reif gewesen. Damit es seine Frieden stiftende Kraft entfalten könne, seien – zumal in Deutschland – erhebliche Bildungsanstrengungen erforderlich, Nachhilfe in Sachen Demokratie besonders: „die Deutschen nämlich seien „die politisch Ungeschulten, die Unpolitischen par excellence“ (DF 21).
Für die Trennung von Staat und Kirche
Um das Selbstverständnis der Kirche und ihr Verhältnis zur Demokratie geht es wesentlich in Annette Kolbs Stellungnahmen zum französischen Laizismus. „Daphne Herbst“ enthält einen Rückblick auf die Zeit seiner Implementierung 1905, in dem „peinlichste Auftritte“ und „Gewaltmaßregeln“ nicht verschwiegen werden, von denen etwa „die Vertreibung der lehrenden Ordensbrüder und Schwestern“ begleitet war (D 29). Übertönt werden sie indes durch wenig schmeichelhafte Einblicke in das Milieu eines aristokratischen Katholizismus mit seinem Kampf gegen die infolge der Ideen von liberté , egalité und fraternité entstandenen „Verirrungen“. Verbindungslinien zwischen autoritär verfasstem Staat und autoritär verfasster Kirche scheinen auf. Politisch und religiös sind die frommen Legitimisten rückwärtsgewandt: „Der Marquis witterte Morgenluft, Restauration“ (D 31), heißt es einmal, und an anderer Stelle ist vom „Fanatismus“ in diesen Kreisen die Rede (D 31).
Das Thema der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich spielt eine wichtige Rolle auch im „Versuch über Briand“, Annette Kolbs knapp 25 Jahre später erschienenem Buch über den damals zuständigen Minister. Selbst schon als Heranwachsende Anhängerin von Lamennais’ frühen Plädoyers für ein Miteinander von Christentum und moderner Freiheitsgeschichte, tadelt sie hier offen jene Mentalitäten, bei denen es „zum guten Ton, vorwiegend auch zur religiösen Erziehung“, gehört habe, „daß man antirepublikanisch war“. 23Politische Prediger seien für die Konfrontation in hohem Maße mit verantwortlich: „Also ein wenig wie bei uns, nur daß in Frankreich auch der gesamte Klerus geschlossen die Regierung befehdete und ihr täglich Waffen in die Hand lieferte, um einer unleidlichen Situation ein Ende zu machen.“ (BR 36)
Aristide Briand habe seinerzeit mit Recht „das hohe moralische Interesse“ hervorgehoben, „welches für die katholische Kirche selbst in einer Trennung vom Staate bestand – und große Katholiken wie Montalembert hatten sie schon in den vierziger Jahren befürwortet“ (BR 33). Zugleich lobt Annette Kolb ihn seiner Kunst der Vermittlung wegen, der es gelungen sei, dem von dieser ausgehenden „Bruch mit der Kurie die letzte Schroffheit zu nehmen“ (BR 37).
Eine machtgeschützte, gesellschaftlich bevorzugte oder auch nur vom Staat geförderte Kirche, erst recht eine, die sich durch eigene Machtinteressen kompromittiert, hält Annette Kolb deren spiritueller Gestalt für abträglich. Durch den Verlauf der Geschichte fühlt sie sich bis ins hohe Alter hinein bestätigt. Tatsächlich habe „das religiöse Leben in Frankreich (...) an Ernst, Geist und innerem Wachstum gewonnen, seitdem es die Rolle des öffentlichen Angreifers einbüßte, seinen Anteil an den Geschäften des Staates verlor“ (B 38). Dem Vorzug, dass „der Klerus (...) dort“ nun „geziemendere Sorgen als die der Tagespolitik“ habe, steht freilich die vielfältige Störung der Messen durch die Kollekten gegenüber, gegen die sie die Erhebung einer Art von „Eintrittsgeldern“ vorschlägt. 24
Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
Nicht nur ihre freiheitlichen Ansichten sind es, die Annette Kolb schon während der Endphase der Weimarer Republik in Widerspruch zur Ideologie der Nazis bringen. Unter der Überschrift „Analphabeten“ lautet eine sarkastische Notiz ihres „Beschwerdebuchs“ (1932): „Im ,Völkischen Beobachter‘ steht, daß die Evangelien kein Wort enthalten, das im pazifistischen Sinne auszulegen sei.“ (B 120) 25Mit den faschistischen Strömungen sieht sie eine gegenchristliche Welt unter dem Vorzeichen den Schwächeren vorenthaltener Gerechtigkeit aufsteigen. Auch den Bolschewisten gilt ihre Kritik. Beim Sozialismus hingegen nimmt sie „ein in die Praxis gesetztes Agens des Christentums, ohne dessen Theorie“, wahr (B 120). Später spitzt sie diesen Satz selbstkritisch zu: „Hätten wir seiner bedurft, wären wir minder schlechte Christen gewesen?“ (SB 144)
Читать дальше