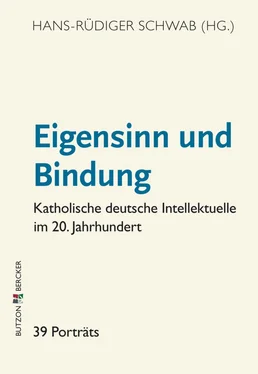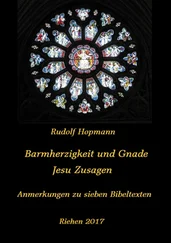Eine weitere Spannung ist bezeichnend für die Psychologie und Dialektik eines von Annette Kolb bevorzugten Typus des intellektuell Katholischen angesichts der Moderne: „zu glauben und nicht zu glauben zugleich“ (D 88 f.). Dahinter verbirgt sich letztlich eine Ahnung jenes vielleicht höchsten Paradoxes, auf welches das religiöse Begriffsvermögen zuläuft: „Wer durfte das Recht des Glaubens beanspruchen, der dem anderen das Recht des Unglaubens bestritt?“ (D 78 f.) Unter diesem Blickwinkel ist wahre Religiosität immer größer selbst als ihre Negation, da sie diese einzubegreifen vermag.
Für ein in die Moderne hinein vermitteltes Christentum
Im Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende setzen Annette Kolbs Bemühungen um eine neue Verhältnisbestimmung zu ihrem katholischen Erbteil ein. Die Heldin der 1905 entstandenen autobiographischen Erzählung „Torso“ hat ebenfalls eine problematische Schulzeit bei Nonnen hinter sich, die sie der Religion „zu sehr entfremdet“ hatte. Nach Umwegen findet sie am Ende wieder zu ihrem „verlorenen (...) Glauben“ zurück (WN 57) – auf einer neuen Ebene allerdings. Vor ihrem Auge gibt sich ein universaler „Mensch“ und „Gott“ zu erkennen, der „auf unnennbar geheimnisvolle Weise alle Widersprüche in sich aufhob“, weil ihm „nichts fremd war“ (WN 55) und „jede Äußerung auf dem Gebiete des menschlichen Geistes“ zu ihm hin „gravitierte (...). Und von der überschwänglichen Tragweite jenes schlichttönenden Ausspruches: ,In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen‘ wurde sie wie von unendlichen Schallwellen fortgerissen und durchleuchtet.“ (WN 56)
Mit Emphase wird ein schöpferischer Entwicklungsprozess des Menschen beschworen, dessen „Apotheose“, im Einklang mit der Botschaft Christi, das Endziel der Geschichte ist. Unter christlichem Vorzeichen äußert sich hier ein dynamisches Weltbild von Möglichkeitsräumen, das an Henri Bergsons „Évolution creatrice“ (1907) gemahnt, einen Text, den Annette Kolb zur Vorbereitung eines durch Max Scheler mit dem französischen Philosophen vermittelten Treffens allerdings erst zwei Jahre später liest.
Während dieser Zeit geraten Vertreter dessen, was seitens der kirchlichen Autorität als „Modernismus“ angeprangert wird, in ihr Blickfeld. Es handelt sich dabei um durchaus verschiedene Bestrebungen, theologische Aussagen mit dem Erkenntnisstand der zeitgenössischen Wissenschaft und Philosophie zu verbinden. In „Das Exemplar“ (dessen Handlung im Sommer 1909 in England spielt) kommt das Gespräch einmal auf den „kürzlich erfolgten“ Tod George Tyrrells (am 15. Juli diesen Jahres), wobei die Protagonistin „sich über die unversöhnliche Haltung des Klerus mächtig ereiferte“ (E 124). Der ehemalige Philosophieprofessor war seiner öffentlichen Kritik an Papst Pius’ X. antimodernistischer Enzyklika „Pascendi“ wegen exkommuniziert worden. Auf dem Totenbett erhielt er zwar bedingungsweise die Sterbesakramente, doch wurde ihm auf Betreiben höchster Stellen ein kirchliches Begräbnis verweigert, weil er keinen formellen Widerruf geleistet hatte. 15Annette Kolbs Mariclée empfindet dieses Vorgehen als skandalös.
Über die Bedeutung eines anderen Indizierten für sie hat die Autorin 1911 einen Essay verfasst, „Besuch bei Duchesne“ (den sie bis 1954 zweimal neu, teilweise modifiziert, veröffentlicht). Der hoch angesehene Kirchenhistoriker Louis Duchesne hatte den Exegeten Alfred Loisy beeinflusst, den Kopf der „modernistischen“ Strömung. Nicht nur in seiner „Histoire ancienne de l’Église“ (1906/11), die 1912 auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurde, war er selbst der kritischen Methode verpflichtet.
Annette Kolb beschreibt Duchesne als Leitfigur einer wünschenswerten katholischen Avantgarde, die mit Blick auf „den kommenden Umbau“ (F 190) Wege in die Zukunft zu weisen vermag: „Nicht mit den Unbedachten und den Fanatikern, die blindlings ein zerfallendes Gemäuer verteidigen, sondern weil er dessen unerschütterliche Basis ergründete, nur deshalb verharrte er standhaften Fußes inmitten des immer hastigeren Gerölles. Gar manche Werte, als unvergänglich ausgegeben, wird es ja als vergangene vor sich hintreiben.“ Dies aber, die Erkenntnis seiner Verhaftetheit auch an zeitbedingte Denkformen, ist die Voraussetzung, um „sich zu einem Katholizismus zu bekennen, von dem die düstere, unziemliche und abgenützte Wörtlichkeit sich endlich löste!“ (F 195) Annette Kolb fordert eine andere Hermeneutik, den Sinn für Unterscheidungen von geschichtlich Vermitteltem, das keine dauerhafte Geltung beanspruchen kann. Wenn sie sich feindselig gegen das zeitgenössische Reflexionsniveau einmauert, läuft die Kirche Gefahr, zur Ruinenbaumeisterin zu werden.
Die für das Selbstverständnis der Autorin nicht hoch genug einzuschätzende Begegnung (F 204) findet um 1903 in Rom statt. In einem langen Gespräch erläutert Annette Kolb Duchesne ihr Verständnis von der Wahrheit als einer „vieldeutigen Einheit“ des Inkommensurablen, die den Menschen deswegen besonders reizt, weil sie sich ihm permanent entzieht: „eine Einheit, die (...) die vielen Wohnungen auch wirklich in sich birgt, von welchen geschrieben steht“ (F 201 f.). Daher müsse es die Aufgabe einer Auseinandersetzung mit „den Dogmen“ sein, „den spekulativen Gedanken auf das äußerste anzuspornen“ (F 201). Duchesne, der „vielangefeindete“ große Gelehrte mit Hang zum Sarkasmus, gibt sich in dieser Situation zugleich „als ein heiliger Priester“ zu erkennen, der das Anliegen seines Gastes ins Recht setzt (F 204).
Auch nachdem wenige Jahre später „in den klerikalen Blättern jene berühmte Hetzjagd“ auf ihn eingesetzt hatte, „bei welcher er als ein Ketzer behandelt“ wurde (F 205) – worin Annette Kolb übrigens einen Bruch des Pontifikats von Pius X. mit dem seines Vorgängers Leo XIII. sieht –, wendet er sich trotz aller Verbitterung nicht von der Kirche ab. In dieser Situation besucht sie den „großen Katholiken“ (F 209) noch einmal, um ihn ihrer Verbundenheit zu versichern.
„Eine reformkatholische Heilige“
Das Verständnis der Heiligen als „eigentlichen Experten des Christentums“ begründet „ein übergreifendes ,modernistisches‘ Interesse an der Hagiographie“. 16Für zwei weitere Arbeiten Annette Kolbs dürfte dieser Kontext nicht außer Acht zu lassen sein. Ein kurzer Essay über das „Leben der Heiligen Walpurga“ (1911) stellt dabei Verbindungen zwischen dem Glauben und der „modernen“ Denkform eines „auf das verstandesmäßige Sehen verzichtleistenden Schauens“ her. Nach Bergson, auf den hier wahrscheinlich Bezug genommen wird, erschließt sich die Wahrheit nicht durch den Intellekt, sondern allein durch „Intuition“. 17
Einen aktualisierenden Akzent anderer Art setzt Annette Kolb gleich zu Beginn des ergänzenden Essays zu ihrer Übersetzung der Briefe der „reformkatholischen Heiligen“ 18Caterina von Siena 1906: 19„Denn wir sind heute so weit wie zuvor: Der Protestantismus wird seiner nicht mehr froh, und die Norm der Katholiken, durch zuviel gescheiterte Reformversuche eingeschüchtert, hat den Glauben an eine römisch-katholische Reformation verloren, jene Reformation, die Catharina nicht müde wird zu verkünden (...). Und wenn heute unsere katholischen Gesellschaften, Vereine usw. ihre fortschrittlichen Bestrebungen verheißen, so belächeln wir im voraus die kümmerlichen Resultate, die sie uns bringen werden. Da dringt denn zu guter Stunde die kühne Sprache Catharinas wie ein frischer Luftzug in eine verbrauchte Atmosphäre.“ (F 111)
Geheimer Mittelpunkt des Essays ist der Gedanke einer evolutionären Perspektive des Christentums, das sich erst allmählich zu seiner vollen Gestalt entfalte. So erklärt Annette Kolb die „extremen“ Selbstkasteiungen der Heiligen als Solidarität mit dem trauernden, nicht dem verklärten Christus angesichts einer Zeit der allgegenwärtigen „Leiden“ und „Grausamkeiten“ in Gesellschaft und Kirche (F 116 f.), „in welcher die Gemüter vom Geist des Christentums noch so wenig umbildet waren“ (F 118). Die eigene Epoche deutet sie als eine Inkubationsphase, einen Zustand jenseits dieser „Greuel“, aber noch nicht unter den „apollinischen Klängen“ des „rätselvollen Auferstehungstages“: „Es ist (...), als träte nunmehr die Welt in das Zeichen der Grablegung, und als dämmerte unsere Zeit, oder die nächstkommende, oder die kommenden Jahrhunderte dem beruhigten, ahnungsvollen Zauber der Kartage entgegen.“ (F 119)
Читать дальше