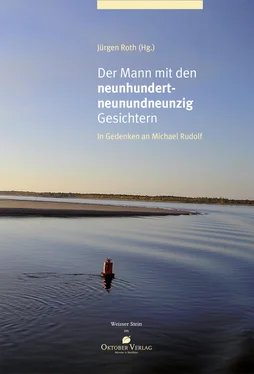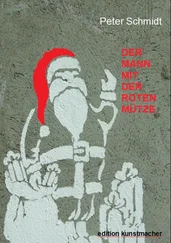Michel fluchte sehr zu Recht, denn zu all dem anderen Unheil war auch noch das Wetter anhaltend garstig. Sehr nasser Wind pfiff kalt am Mainzer Rheinufer entlang, und die nötige Flucht nach vorne, vom öd-belebten Messezelt (Michel: »Ich weiß nicht, was schlimmer ist: die Kleinverlegerkollegen oder das Publikum«) hin zum nahen Zentrum der rheinland-pfälzischen Hauptstadt, führte uns Ortsunkundige auch zu rein gar nichts Gutem.
Einzig unsere Unterkunft gab Anlaß zu gehobenem Plaisir. In ein eindeutig am Zielpunkt langer Talfahrt hart aufgeschlagenes Hotel aus wilhelminischen Tagen, nahe am Mainzer Hauptbahnhof, hatten uns die Experten der Touristenbehörde eingewiesen. Michel und Gerd stöhnten halb amüsiert, halb echt geschockt: Als noch verblichener als einige der wildesten Kaschemmen, die sie auf Lesetour durch die noch sehr jungen Neuen Bundesländer kennen- und fürchten gelernt hatten, zeigte sich dieses erahnbar ehemals noble Haus. Tapeten mit Müsterchen, die man problemlos jedem fachlich noch so fitten Kurator psychopathologisch orientierter Kunstsammlungen als ewige Glanzstücke seiner Bestände unterschieben könnte, mobiliarhaftes Geraffel, dessen Schoflesse selbst hartgesottene Sperrmüllexperten in die innere Emigration gescheucht hätte, und eine Gesamtatmosphäre wie in gewissen schwarzweiß gehaltenen Meisterwerken des osteuropäischen Filmdramenrealismus der ganz frühen sechziger Jahre. Zu trinken gab es in dieser ungemütlichen Herberge am Abend sowieso nichts mehr, nicht mal Fernsehkästen standen bereit, und draußen tobten weiterhin Sturm und Regen. Also saßen wir erst mal matt in einem unserer Zimmer herum und klagten über das laue Gedöns bei der Kleinverlagsbuchmesse.
Einer von uns, ich meine, es war Michel, entdeckte dann den kleinen merkwürdigen Kasten. Auf dem Nachttisch, unterm Schirm einer kleinen Funzellampe. Ein dunkel lackiertes, gut abgegriffenes, simpel verarbeitetes Blechkistchen, mit alten Stromschaltern auf der Oberseite und einem Schlitz wie auf einem Kollektenschrein, groß mit dem Hinweis »DM 1« beschriftet. Ein dickes Kabel verlief von diesem Instrument ins Dunkel unterm Bett. Rätsel über Rätsel. Michel hatte ein Markstück zur Hand und steckte es, nur mäßig gespannt, was für Attraktionen nun eintreten würden, in den Schlitz. Augenblicklich erhob sich ein schnarrendes Gequengel aus dem muffigen Inneren des Bettes, ein ungesund klingendes elektrisches Eiern, wie von einem Handmixer kurz vor seiner endgültigen Havarie. Und das noch abgedeckte Bett begann sich zu regen, bäumte sich partiell um ein paar Zentimeter auf, ungefähr in der Mitte der Liegefläche, schön im blöd fickrigen Takt des Geknatters, anzusehen etwa so, als übe ein mit schlechten Amphetaminen großzügig gedopter, zornig bockender Goldhamster unter der Decke einbeinig einen Veitstanz ein. Michel erstarrte, er hielt den Geldschlitzkasten in Händen wie ein überforderter Meßdiener sein Monstranzenzeugs während einer unvermuteten Herrgottserscheinung, guckte einigermaßen verdattert auf das, was er da angerichtet hatte, und wußte erst mal überhaupt nicht mehr weiter. Gerd Henschel, der hinsichtlich des weiteren Verlaufs dieses Abends auch schon alle Hoffnung aufgegeben und nur einen Schritt neben Michel gut aufgepaßt hatte, was nun geschehe, gewann als erster seine Fassung zurück und lachte sich schier scheckig. Von diesem, Gerds erstem Ausbruch baren Vergnügens an diesem sonst voll vergeigten Tag ermutigt, betätigte Michel nun einen mit 1, 2 und 3 beschrifteten Schalter, und sofort gehorchte das Bett, indem das ratternde, leicht hoppelnde Geknatter sich nun auch noch in wechselnden Frequenzen hören ließ, je nach Grad der ihm fernlenkerisch befohlenen Erregung.
Noch bevor nach etwa einer Minute der Spuk erlahmte, hatten wir unsere sämtlichen Markstücke hervorgekramt, und Michel, er hatte gefaßt und beherzt die Rolle des Ingenieurs und Leiters des Experiments übernommen, fütterte erneut den Kasten mit Barem. Gerd Henschel, der nun auch noch wissen wollte, was genau die Ursache der Erscheinungen sei, deckte vorsichtig das Bett ab, hob mit spitzen Fingern die Matratze an und stieß auf ein weiteres, auf dem Lattenrost wackelig-schief befestigtes Kästchen, aus dessen Oberseite ein kleiner Stößel herausklopperte, zweifellos dafür geschaffen, per pochender Einwirkung auf die Matratze eine oder mehrere auf dem Bett situierte Personen mechanisch zu bearbeiten.
Ein geprägter Schriftzug auf einem der Kästen wies per Wortspiel auf das gewisse Massagehafte der dem Apparat eigenen Regungen hin. Den völlig perplexen Gerd Henschel hielt nun gar nichts mehr auf den Beinen. Laut lachend und die Hände über dem Kopf zusammenschlagend, wälzte sich der junge Dichter auf der durchfallfarbenen Auslegeware. Irgendwann, mehrere Markstückel waren verjuckelt, ließ sich einer von uns auf den Rand des kinetischen Betts fallen, das sofort weitgehend durch- und zusammenkrachte und nun wie ein am Orkus gestrandetes Floß handwerklich ungeschickter Schiffbrüchiger dumm vor der Wand hing – bei immer noch stur tuckerndem, erstaunlich standfestem Stößelmechanismus. Ein grandioser Anblick, beinahe rührend schon, ergreifend wie eine von Beate Uhse gesponsorte, eingedenk Sigfried Giedions Studie über Die Herrschaft der Mechanisierung multimedial zur Metapher des universell Deppenhaften versaubeutelte Paraphrase von Caspar David Friedrichs großem Bild der vor dem gefrorenen Meeresufer gescheiterten Hoffnung, mit der man Harald Szeemanns kompletter Ausstellung »Junggesellenmaschinen« von 1975 mit links Konkurrenz machen könnte. Gerd Henschels Lachkrampf war endgültig ins Chronische entgleist.
Michel aber ließ sich zu fast anzüglich politischen Bemerkungen zum Nimbus der westdeutschen Hotellerie hinreißen, nicht die letzten Witze dieses so im letzten Augenblick noch geretteten Abends im stark faden Mainz. Am Morgen gelang es uns, das Bett immerhin so scheinbar gerade wieder aufzurichten, daß es zumindest auf den ersten Blick wie intakt aussah. Zur Minipressenmesse nach Mainz sind wir drei dann nie mehr gefahren.
»EIN GENTILER HERR« – Aus Michels Mund habe ich nie eine Zote oder ähnliches gehört. Er konnte fluchen, auch schimpfen; aber er wurde nie auch nur andeutungsweise ausfallend. Selbst in grenzwertigen Situationen nicht.
Als ich mal mit ihm vor einem Drehkreuz am Eingang zum Frankfurter Messegelände stand, wurde er beinahe von einer wuchtig daherstampfenden Dame, einer riesigen Gestalt von ungeheurer Blunzenhaftigkeit, umgerempelt. Er wich im letzten Augenblick elegant aus, machte auch noch einen leichten Diener, wies lächelnd aufs Drehkreuz und sagte doch tatsächlich: »Madame …« Das Monster, das um ein Haar im Drehkreuz steckengeblieben wäre, japste kurz auf und blaffte Michel grob an: »Die Madame könnense sich sonstwo hinstecken!« Erst als diese Person außer Hörweite war, sagte Michel »Um Himmels willen« und grinste nachsichtig.
Keine zehn Minuten später saßen wir gemütlich am Buchmessenstand des Haffmans Verlages, als genau jenes Monstrum wieder auftauchte, sofort laut nach dem Verleger verlangte, sich zwischen Umherstehende drängelte und schnaubend signalisierte, daß es fixe Bedienung erwarte. Michel war begeistert. Er trat zu Gerd Haffmans, der sich mit Autoren unterhielt, faßte ihn leicht am Ärmel und sagte, auf die Besucherin weisend: »Herr Haffmans, diese Dame hier hätte ein Begehr …« Nun mußte halt der arme Gerd Haffmans ran, der anschließend ganz daddelig aus seinem schönen Anzug schaute. Denn das Ungeheuer war als Journalistin unterwegs und wollte dringlich zu einem Interview mit der Jungautorin Amanda Filipacchi vorgelassen werden, deren aktuell als leicht skandalös berüchtigter Roman Nackte Männer unter dem Hinweis »Der Roman einer Erotomanie – süß wie die Sünde selbst«, versehen mit dem Foto einer merkwürdig halbnackten Frau auf dem Umschlag, im Haffmans Verlag gerade auf deutsch erschienen war. Der Verleger wußte mit reichlich Mühe seine Autorin vor dem Schlimmsten zu bewahren und seufzte nach dem Weggang der in Bud-Spencer-Pose vor ihn hingetretenen Frau ernstlich geschlaucht: »Jetzt brauch’ ich was zu trinken.«
Читать дальше