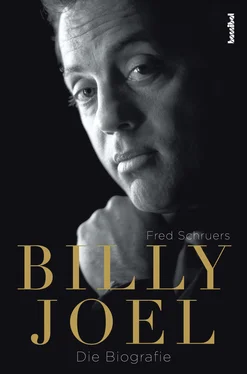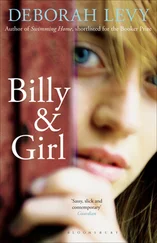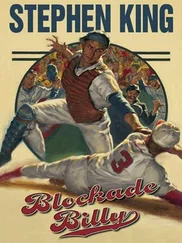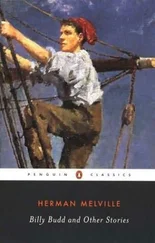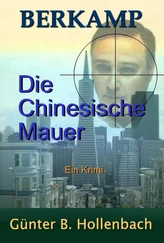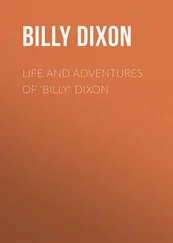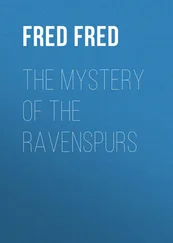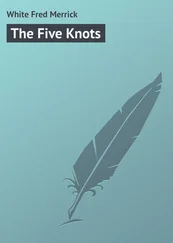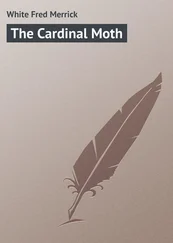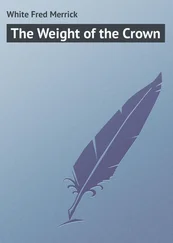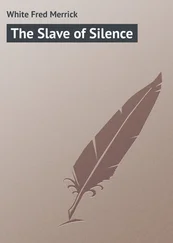Zwischen Judy und Billy entwickelte sich ein enges Band, wie sich später unter anderem in Songs wie „Why Judy Why“ vom Album Cold Spring Harbour (1971) ablesen ließ. Billy singt hier ganz offen: „Of all the people in the world that I know/ You’re the best place to go when I cry.“ „Judy und ich blieben immer sehr miteinander verbunden“, sagte Billy. „Sie wuchs wie meine Schwester auf, und ich habe sie auch immer so betrachtet. Damals waren wir beide Verbündete in den schwierigen Tagen in der Meeting Lane.“
Judy war 15, als Roz ihr zum ersten Mal von den tragischen Umständen berichtete, die ihrer Adoption vorausgegangen waren. Das Gespräch fand an Marilyn Monroes Todestag statt, dem 5. August 1962; Billy und Judy hatten den Eindruck, dass dieses Ereignis für Roz von großer Bedeutung war, da sie in der oft so unglücklichen Hollywood-Schauspielerin offenbar eine verwandte Seele erkannte.
Es war tatsächlich eine sehr düstere Geschichte. Muriel wurde von der Familie Moochie genannt und von einer Verwandten als „Bücherwurm … schüchtern, lustig und eine gute Köchin“ beschrieben. Nach Judys Geburt 1947 litt sie an einer schweren Kindbettdepression. Sie hatte ihren Ehemann Max, einen Buchhalter, mit 19 in der Brooklyn Town Hall geheiratet; das Hochzeitsfrühstück hatte anschließend in Chinatown stattgefunden. In den folgenden acht Ehejahren zeigte Max Berichten zufolge wenig Verständnis für seine Frau und war vermutlich schon mit einem Fuß aus der Tür, als ihr zweites Kind zur Welt kam. Eines Tages – Judy war acht Wochen alt, ihre vier Jahre alte Schwester Susie war bei Muriels Mutter Rebecca – legte Muriel die kleine Judy im hinteren Schlafzimmer ihrer Wohnung in Flatbush aufs Bett, schob ein paar Stühle davor, damit sie nicht herausfallen konnte, und schlug ein Fenster ein, damit ausreichend Frischluft ins Zimmer gelangte. Dann ging sie in die Küche, hängte eine schwere Armee-Wolldecke vor den Eingang, öffnete die Ofenklappe und drehte den Gashahn auf. Judys Tochter Rebecca Gehrkin berichtet, dass sie gut sichtbar eine Nachricht hinterließ: „Liebe Mom, Pop und Max, ich weiß, dass ich Krebs habe. Ich will der Familie nicht zur Last fallen, deswegen habe ich diesen Ausweg gewählt. Bitte vergebt mir. Alles Liebe, Mooch.“
„Meine Großeltern kehrten nach Hause zurück und fanden sie ausgestreckt am Boden liegend“, berichtet Judy. „Etwas später kamen Roz und meine biologische Schwester, Susan. Roz warf sich auf Moochie, rief immer wieder ihren Namen und versuchte sie wiederzubeleben. Es gelang ihr nicht, aber sie ließ sich nicht von ihr wegziehen.“
Die Familie war so erschüttert, dass nur Muriels Ehemann Max an der Beerdigung teilnahm. Er begann ein neues Leben, nahm Susie mit und heiratete innerhalb eines Jahres erneut. Die kleine Judy ließ er bei Billys Großeltern, Phillip und Rebecca Nyman, in Brooklyn. „Später dann“, sagt Billy, „als Judy etwa vier war, kam sie zu uns nach Hicksville, und ich hatte plötzlich eine Schwester, die ich kaum kannte.“ Billy hat zwar recht positive Erinnerungen an Roz, die sich seiner Meinung nach sehr darum bemühte, dass die Familie in den kommenden Jahren genug zu essen, etwas anzuziehen und gelegentlich auch einmal etwas zu lachen hatte, aber Judy äußert sich recht bitter über ihre Pflegemutter: „Roz machte einige nicht besonders nette Sachen. Einmal, als wir noch sehr klein waren, ließ sie uns drei Tage lang allein.“
Dieser Vorfall führte zu einem ausgedehnten Familienstreit über Kindererziehung, aber so sehr Judy auch unter Roz’ Launen litt, fand sie die Besuche bei der Joel-Seite der Familie in Upper Manhattan ebenso wenig angenehm: „Sie waren eiskalt – so wie man sich typische Deutsche vorstellt.“
Die Spannungen zwischen Roz und Judy, die 1955 offiziell adoptiert wurde, blieben bestehen. „Judy war in den folgenden Jahrzehnten nur zu sehr eingeschränktem Kontakt mit unserer Mutter bereit“, sagt Billy. „Es gab zu viel Konfliktpotenzial und zu viele unglückliche Vorkommnisse.
Mir wurde ziemlich schnell klar, dass meine Familie ganz anders war als die anderen in der Nachbarschaft. Schon allein, weil mein Vater nicht oft zu Hause war. Natürlich sah ich ihn, sicher, aber er war kein fester Bestandteil unseres Haushalts. Die meiste Zeit waren es nur meine Mutter, meine Schwester und ich. Und damals dachte ich eben, dass wir die Familie ohne Vater waren, die natürlich auch von den Nachbarn so wahrgenommen wurde. Wir wurden nicht ausgegrenzt, aber man hat uns schon anders angesehen. Viel Geld hatten wir auch nicht, und von daher kamen wir auch nicht in den Genuss kleiner Annehmlichkeiten, wie es sie in anderen Haushalten gab. Das waren Kleinigkeiten, aber sie fielen eben auf – wir konnten es uns nicht leisten, eine gepflasterte Auffahrt anzulegen, eine Gaube ins Dach einbauen zu lassen oder irgendwelche anderen Aufwertungen an unserem Haus vorzunehmen, so wie das die Nachbarn taten.“
Und dann geriet natürlich auch Roz ins Visier der wachsamen Nachbarn, weil sie, wie Judy berichtet, das Bankkonto der Familie mit impulsiven Einkäufen stark belastete und gelegentlich wohl auch Hochprozentiges trank. Auch gab es Zeiten, in denen sie nicht essen wollte: „Eines Tages kam ich nach Hause, und Billy saß auf ihrem Schoß und schob ihr löffelweise Eiskrem in den Mund, weil er Angst hatte, dass sie stirbt.“
Die soziale Kontrolle durch die Nachbarschaft war nicht dazu angetan, die Stimmung in dem kleinen, engen Haus zu verbessern. Die Meeting Lane war ein ungeschütztes, flaches Stück Land, ein ehemaliger Kartoffelacker, auf dem in der kurzen Zeit seit dem Krieg noch nicht allzu viele Bäume oder Sträucher gewachsen waren, und die Anwohner urteilten hart über einander, wie Judy erzählt: „Wir waren die einzigen Juden, wir waren die einzige Familie ohne gepflasterte Einfahrt – wir hatten statt einer Garage einen Carport. Die Leute haben sich über uns lustig gemacht.“
„In den Fünfzigerjahren wurde eine attraktive Frau in einer Nachbarschaft voller verheirateter Männer mit einem gewissen Misstrauen betrachtet“, sagt Billy. „Unsere Gegend war sehr katholisch geprägt, und auch das trug natürlich dazu bei, dass wir uns immer etwas anders fühlten. Als ich etwa sechs war, sagte zum Beispiel einmal das kleine Mädchen von gegenüber ganz nüchtern zu mir: Dir werden später mal Hörner wachsen, weil du ein Jude bist. Und ganz ehrlich, als ich an dem Abend ins Bett ging, da habe ich meinen Kopf abgetastet, um zu fühlen, ob die Hörner sich schon bemerkbar machen. Von Antisemitismus hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, was ein Jude war, abgesehen von dem, was ich mir aus den Bemerkungen der anderen Kinder zusammengereimt hatte. Man darf nicht vergessen, das war in einer Zeit, als political correctness noch ein Fremdwort war. Damals wurden alle möglichen rassistischen Ausdrücke benutzt – Polacke, Mick für die Iren, Spic für alle, die eigentlich Spanisch sprachen, Kike für die Juden und vor allem das Wort mit N. Das machte jeder, ganz ungeniert. Es dachte dabei auch niemand an Rassismus, die Leute redeten einfach so. Allerdings hatte diese ganze Bigotterie auch ihr Gutes: Man konnte sie meilenweit erkennen. Heute findet all das mehr im Verborgenen statt, aber ich glaube, dass es noch genauso da ist wie früher.“
Zwar galten die USA als „Schmelztiegel“ – der Ausdruck melting pot war 1906 in einem Theaterstück geprägt worden, das von einem Russen handelte, der die Pogrome in seiner Heimat überlebt hatte und sich nun in der neuen Umgebung anzupassen versuchte. In der Meeting Lane zeigte sich aber vor allem, wie schmerzvoll dieser Prozess für die Betroffenen war. Möglicherweise war Howard Joel deswegen so häufig unterwegs, weil er sich ständig fragte, wofür er in Europa eigentlich gekämpft hatte, was er verloren hatte und ob es ihm wirklich gelungen war, den Vorurteilen zu entkommen, die diese Katastrophe ausgelöst hatten. Er ließ keine Gelegenheit aus, um die materialistische, ungebildete Kultur zu geißeln, in die er hineingeraten war – jene robuste amerikanische Wirtschaft der Nachkriegszeit, in der er gezwungen war, Plastikwaren unter die Leute zu bringen. „Er hasste Amerika“, sagte Billy, der später energisch versuchte, den Tiraden seines Vaters zu widersprechen. „In den seltenen Zeiten, wenn mein Vater zu Hause war, umgab ihn etwas Düsteres. Später sagten die Leute, der Krieg hätte ihn verändert. Als ich sechs war, sagte er einmal etwas, das ich nie vergessen habe: Das Leben ist eine Jauchegrube. Er sagte ja nie viel, aber das hat sich mir eingeprägt. Jahre später wurde mir klar: Das war eine ziemlich harte Bemerkung gegenüber einem Kind.“
Читать дальше