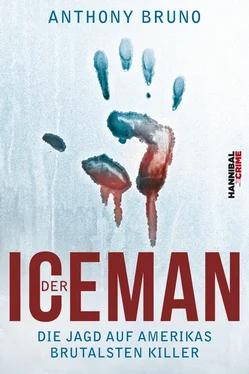Es wäre genauso, als würde man Richard fragen, was er beruflich tat. Sie wusste, dass er sich mit irgendwelchen internationalen Finanzgeschäften befasste, weil zu allen Tages- und Nachtzeiten aus der ganzen Welt Anrufe ins Haus kamen; außerdem traf er sich hier und da mit Geschäftspartnern. Aber etwas Genaueres hatte sie nie erfahren, und sie wollte es auch gar nicht. Wenn Richard um drei Uhr morgens aufstand, sich anzog und wegging, stellte sie sich schlafend. Gelegentlich erzählte er ihr von irgendwelchen Leuten, mit denen er zu tun hatte, aber das war etwas anderes. Grundsätzlich hütete sie sich vor Fragen. Es war besser so. Sie wusste, dass ihr Ehemann kein Engel war, und da er für seine Familie sorgte, vermied sie jede unnütze Neugier. Das hätte nur bedeutet, Schwierigkeiten heraufzubeschwören.
Sie warf die Brotstückchen ins Wasser und musterte ihn mit einem verstohlenen Blick. Er schaute wieder über seine Schulter hinüber zum Telefon. Offenbar wollte er sichergehen, dass keiner es benutzte, falls er plötzlich jemand anrufen musste. Nur Gott mochte wissen, was er tun würde, wenn irgendein armer Teufel daherkam und versuchte, sein Telefon in Beschlag zu nehmen.
Plötzlich ertönte Richards Pieper, und die Enten zu ihren Füßen stoben erschrocken davon. Er löste das Gerät von seinem Gürtel und musterte die Anzeige. Richard war ganz fasziniert von diesem neuen Spielzeug. Seit er diesen Pieper hatte, schaltete er daheim den Anrufbeantworter nicht mehr ein und ging nie mehr ohne dieses Ding irgendwohin. Sogar im Haus trug er ihn bei sich.
Richard stand von der Bank auf.
»Wer ist es?«, fragte sie, obwohl es sie eigentlich nicht interessierte. Sie wollte einfach, dass er bei ihr blieb und sich entspannte, so wie immer.
Er schaute durch die dunklen Brillengläser auf sie herab. »John.«
»Ach so«, nickte sie und wandte sich wieder den Enten zu, während er davonging.
Richard hatte früher nie von hier aus Telefonanrufe erledigt. Der Ententeich war immer ein geheiligter Platz gewesen. Diese Zeit gehörte nur ihnen allein. Hier hatte der gute Richard seine Batterien neu aufladen können. Manchmal waren sie jeden Tag hergekommen. Sie frühstückten irgendwo gemeinsam, gingen dann zum Teich, hielten Händchen, fütterten die Enten und saßen ruhig und einträchtig schweigend nebeneinander. Richards Benehmen war stets tadellos zuvorkommend. Wenn es kalt wurde, legte er eine Decke für sie auf die Bank, breitete eine andere über ihren Schoß aus und polsterte mit einem Kissen die Rückenlehne. Er war rührend um sie besorgt. Es gab nichts Wichtigeres für ihn als sie. Das war das ganze Problem.
Richard war besessen von ihr. Er wollte in jedem einzelnen Moment wissen, wo sie war, und deshalb wollte er sie ständig zu Hause bei sich haben. Die vergangenen Jahre hatte sie bei einer Telemarketing-Firma gearbeitet. Zunächst war der Job kaum der Rede wert gewesen, aber sie hatte sich hochgearbeitet bis zur Schichtleiterin und hatte Spaß an ihrem Beruf. Es war der erste Job, den sie seit der Hochzeit angenommen hatte, und durch ihn hatte sie ein ganz neues Selbstwertgefühl gewonnen. Aber Richard hasste diesen Job.
Er bedrängte sie zu kündigen und versuchte, sie unter Druck zu setzen. Wiederholt strich er um das Gebäude herum, spähte durch die Fenster und spionierte ihr nach. Eines Abends holte er sie ab und sah einen Kollegen, der zufällig mit ihr gemeinsam zum Parkplatz ging. Der Mann bedeutete ihr absolut nichts, es war einfach jemand, mit dem sie zusammenarbeitete, aber als sie in den Wagen stieg, trug Richard seine dunkle Brille. Wenn sie nicht sofort kündige, meinte er nüchtern, würde ihrem ›Freund‹ etwas Schlimmes passieren. Sie wusste, dass es ihm ernst war, und gab am nächsten Freitag ihre Stelle auf. Das war vor sechs Wochen gewesen.
Es ließ sich schwer sagen, ob diese wahnwitzige Eifersucht eine Seite des guten Richards oder des bösen war. Vermutlich gehörte es ein wenig zu beiden. Er liebte sie wirklich – daran hatte sie keinen Zweifel, aber es war eine beinahe abartige Liebe.
Er verlangte in allem Perfektion und wollte, dass seine Familie dem Bild der perfekten amerikanischen Familie entsprach. Nichts machte ihn glücklicher, als gemeinsam etwas zu unternehmen. Wenn sie alle gut angezogen in ein nettes Restaurant ausgingen, platzte er vor Stolz und Freude. Aber inzwischen waren die Kinder älter – Merrick war einundzwanzig, Christen zwanzig, und Dwayne war in der Abschlussklasse der Highschool –,
und sie hatten alle ihr eigenes Leben. Sie wollten mit ihren Freunden zusammen sein, nicht mit den Eltern – wenigstens nicht andauernd, was für Richard völlig unverständlich war. Es traf ihn tief, wenn eines der Mädchen es ablehnte, mit ihm femzusehen, weil sie etwas anderes vorhatte. Er begriff nicht, dass die Kinder erwachsen wurden und auf eigenen Füßen stehen wollten. Barbara fürchtete sich vor dem Tag, wenn sich eines von ihnen entschied, das gemeinsame Nest zu verlassen. Das würde nicht ohne Auseinandersetzung abgehen.
Aber wenigstens war er ihnen gegenüber nie handgreiflich geworden, auch wenn er sie sicher oft auf andere Weise verletzt hatte. Selten fand er ein Wort der Anerkennung: Hatte es Zeugnisse gegeben, lobte er sie nie für die Einsen, sondern schimpfte über die Zweien. Doch das entsprach Richards Lebenseinstellung: Das Glas war immer halb leer und nichts, absolut nichts, war gut genug. Nicht für ihn.
Aus diesem Grund war ihm Geld so wichtig. »Es sind die Scheinchen, worauf’s ankommt, Baby«, sagte er stets zu ihr. Geld war das Einzige, das ihn glücklich machte – Geld und was man sich damit leisten konnte. Er liebte es einzukaufen – Kleider von Christian Dior für sie, spontane Urlaubsreisen, Diamanten und Schmuck für die Mädchen, lächerliche Spielzeuge für Dwayne, wie dieser Jagdbogen, der nie benutzt worden war. Man konnte einen Bären damit erlegen, aber letztendlich hing das Ding einfach an der Wand in Dwaynes Zimmer und setzte Staub an. Doch das war typisch Richard. Er dachte sich nichts dabei, vier-, fünf-, sechshundert Dollar für eine einzige Mahlzeit auszugeben. Wenn es um seine Familie ging, spielte der Preis keine Rolle.
Alle sechs Monate musste ein neuer Wagen her, das war ein regelrechter Tick bei ihm. Dwayne hatte er den blauen Camaro gekauft, den sie aktuell fuhren, der so aufgemotzt war, dass der Junge zu Hause anrufen musste, als er das erste Mal damit unterwegs war. Er kam mit diesem hochfrisierten Schlitten einfach nicht zurecht. Richard musste ihn abholen und das Auto zurückfahren. Jetzt sprach er ständig davon, ihm einen Lamborghini Excalibur zu kaufen, und fragte Dwayne augenzwinkemd, was die Priester in der Schule wohl sagen würden, wenn er in einem solchen Prachtstück Vorfahren würde.
Barbara schüttelte einfach den Kopf. Es war sinnlos, mit ihm über solche Sachen vernünftig reden zu wollen: Wenn er beschloss, dass sie etwas haben mussten, war nicht mehr daran zu rütteln.
Allein Geld und das, was man damit kaufen konnte, gab ihm das Gefühl, jemand zu sein. Als Kind hatte er in ärmlichen Verhältnissen gelebt und immer gespürt, dass er ein Niemand war. Jetzt hatte er Geld, und nur dadurch war er jemand. Sie kannte seine Einstellung. Man war wertlos ohne Geld in der Tasche, ohne einen Cadillac und ohne die Möglichkeit, sich zu kaufen, was immer man wollte und wann immer man es wollte. Allein dadurch war man Richards Ansicht nach jemand.
Geld. Darum drehte es sich, und genau das war der Auslöser, der den bösen Richard zum Vorschein brachte. Es wiederholte sich jedesmal, wenn ein finanzieller Engpass drohte. Und obwohl sie nicht im Traum daran denken würde, ihn zu fragen, wusste sie, dass es im Augenblick wieder so weit war. Sie konnte es förmlich riechen. Woher das Geld kam, wollte sie gar nicht wissen. Einiges stammte aus Richards Firma, der Sunset Company, die er nach der Straße in Dumont, wo sie lebten, benannt hatte. Richard handelte mit ausländischen Währungen, und seine Geschäfte führten ihn oft nach England und in die Schweiz. Soweit sie wusste, war das alles legal, weil er dieses Einkommen ordnungsgemäß versteuerte. Im Juni war er beruflich nach Zürich gereist, um eine große Summe in nigerianischer Währung zu verkaufen. Er hatte sich viel von diesem Geschäft versprochen, denn er redete davon, im superreichen Saddle River ein Haus zu kaufen, von dem er völlig besessen war, ein Anwesen für eine Million Dollar, in unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Präsidenten Nixon. Aber als er aus der Schweiz zurückkehrte, war er in übelster Stimmung. Der Handel war in letzter Minute geplatzt. Man habe ihn ausgetrickst, fluchte er immer wieder. Das Haus in Saddle River wurde danach nie mehr erwähnt.
Читать дальше