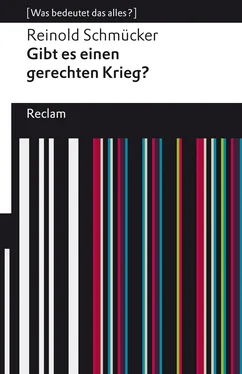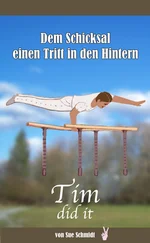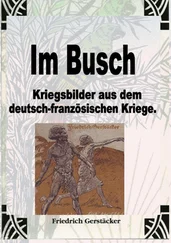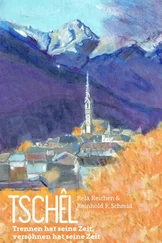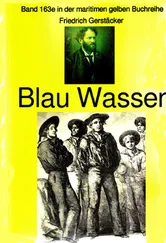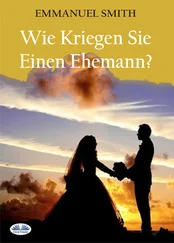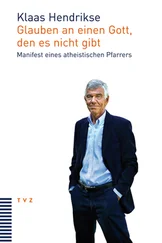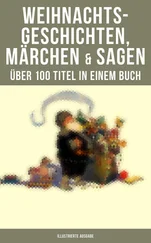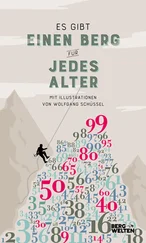Reinold Schmücker - Gibt es einen gerechten Krieg?
Здесь есть возможность читать онлайн «Reinold Schmücker - Gibt es einen gerechten Krieg?» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Gibt es einen gerechten Krieg?
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gibt es einen gerechten Krieg?: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gibt es einen gerechten Krieg?»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Gibt es einen gerechten Krieg? — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gibt es einen gerechten Krieg?», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Erstens kann die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation, die im einen Fall unter Umständen sehr viel höher ist als in einem anderen, meines Erachtens nicht generell so hoch veranschlagt werden, dass aus ihr die faktische Aufhebung des Selbstverteidigungsrechts von Staaten und sozialen Gruppen folgt. Denn die Behauptung, dass »heute jeder Krieg notwendigerweise eine Form automatisierter Massenvernichtung«25 sei, ist empirisch – durch den Sechs-Tage-Krieg ebenso wie durch den Kosovokrieg der NATO und viele andere Kriege – widerlegt. In vielen Fällen ist zwar die Gefahr der Eskalation eines Krieges groß; daraus folgt jedoch nicht, dass die Selbstverteidigung mit militärischen Mitteln prinzipiell illegitim ist. Vielmehr folgt daraus allenfalls, dass sie illegitim ist, wenn eine solche katastrophische Zuspitzung nicht mit hinreichender Sicherheit vermieden werden kann.
Zweitens beruht das Argument auf einer Abwägung, die schon im Grundsatz fehlerhaft ist. Denn das Argument, der Gebrauch militärischer Mittel sei selbst in einem Fall legitimer Selbstverteidigung prinzipiell illegitim, weil das mit einem Krieg verbundene Eskalationsrisiko das Selbstverteidigungsrecht prinzipiell überwiege, gewichtet den legitimen Wunsch Dritter, nicht durch eine Eskalation in einen Krieg hineingezogen zu werden und nicht durch eine Eskalation Schaden zu erleiden, prinzipiell höher als das Selbstverteidigungsrecht eines zu Unrecht angegriffenen Staates oder einer mit militärischen Mitteln terrorisierten sozialen Gruppe. Ihnen, die ja bereits Opfer militärischer Gewalt geworden sind, drohen nämlich durch eine Eskalation nicht in jedem Fall größere Schäden als die ihnen ohnehin bereits entstandenen. Eine derart grundsätzliche Bevorzugung der Interessen derer, die durch illegitime militärische Gewalt (noch) keinen Schaden erlitten haben, gegenüber den Interessen derjenigen, die bereits Opfer solcher Gewalt geworden sind, lässt sich jedoch auch nicht durch den Hinweis, dass die noch nicht Betroffenen in der Regel in der Überzahl sein dürften, überzeugend begründen.
Die Auffassung, dass es unter allen Umständen illegitim ist, Krieg zu führen, ist deshalb mit der in allen Kulturen weithin anerkannten Legitimität individueller wie kollektiver Selbstverteidigung nicht vereinbar. Auch die außerordentlichen Schwierigkeiten, die mit der Entscheidung darüber verbunden sind, ob das Führen eines Krieges ein Akt der Selbstverteidigung ist oder nicht, ändern an diesem Ergebnis nichts. Denn die Schwierigkeit der Abgrenzung von Selbstverteidigungsakten und anderen Handlungen erlaubt nicht den Schluss, Selbstverteidigung sei illegitim. Es fiele uns ja auch nicht ein, von der Schwierigkeit, Hilfe von Bevormundung zu unterscheiden – zum Beispiel bei der Betreuung kranker oder alter Menschen –, darauf zu schließen, dass Hilfe illegitim sei.
Zwischenfazit
Auf die Frage, ob es einen gerechten Krieg gibt, können wir daher die folgende vorläufige Antwort geben:
(1) Die Legitimität der kollektiven Selbstverteidigung eines Staates oder einer sozialen Gruppe lässt sich nicht grundsätzlich bestreiten.
(2) Es ist nicht kategorisch ausgeschlossen, dass die legitime Selbstverteidigung eines Staates oder einer sozialen Gruppe den Einsatz militärischer Mittel erforderlich macht.
(3) Die Möglichkeit eines von einer Seite legitimerweise geführten Krieges lässt sich daher nicht prinzipiell, d. h. ohne Ansehung der im konkreten Fall jeweils gegebenen Umstände, verneinen.
3. Kann ein Angriffskrieg moralisch erlaubt sein?
In einem Fall, so haben wir festgehalten, ist die Legitimität des Einsatzes militärischer Mittel weithin anerkannt: Als Akt der Selbstverteidigung ist das Führen von Krieg legitim, also moralisch erlaubt (und nach dem geltenden Völkerrecht auch legal, also auch von Rechts wegen erlaubt). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Einsatz militärischer Mittel zur Abwehr eines ungerechtfertigten Angriffs erforderlich ist. Wir sind nämlich nicht bereit, jeden Akt der Selbstverteidigung als legitim einzustufen. Indem wir Selbstverteidigungsakte als moralisch erlaubt erachten, wenn sie sich gegen einen illegitimen Angriff richten, ziehen wir vielmehr auch die Möglichkeit eines legitimen Angriffs in Betracht. Und wir knüpfen die Legitimität eines Selbstverteidigungsakts nicht nur daran, dass dabei keine anderen Mittel eingesetzt werden als die, die zur Selbstverteidigung erforderlich sind. Vielmehr halten wir Selbstverteidigung auch nur dann für legitim, wenn sie einem Angriff gilt, der ungerechtfertigt ist.
Ein Beispiel zeigt das ganz deutlich: Würde ein Luftpirat, der ein Flugzeug als Waffe zu benutzen und zum Absturz zu bringen sucht, von einem Passagier oder Besatzungsmitglied mit dem Ziel attackiert, dadurch das Leben der an Bord befindlichen Menschen zu retten, so würde ihm wohl kaum jemand ein moralisches Recht auf Selbstverteidigung zusprechen. Offenbar hat er sein Selbstverteidigungsrecht in dieser Situation durch sein eigenes Handeln verwirkt. Diese Annahme legen jedenfalls wohl den meisten Menschen ihre moralischen Intuitionen nahe.
Entsprechend haben auch Staaten (und andere Kollektivpersonen) kein unbedingtes Selbstverteidigungsrecht, das einem Staat etwa allein deshalb zukäme, weil er existiert.26 Legitim ist auch die Selbstverteidigung eines Staates oder einer sozialen Gruppe vielmehr nur dann, wenn sie einem illegitimen Angriff gilt. Emer de Vattel (1714–1767) hat das schon 1758 sehr klar ausgesprochen (und sogar eine Selbstverteidigungspflicht eines zu Unrecht angegriffenen Staates angenommen):
Der Verteidigungskrieg ist gerecht, wenn er gegen einen ungerechten Angreifer geführt wird. Das bedarf keines Beweises. Die Selbstverteidigung gegen eine ungerechte Gewalt ist für eine Nation nicht nur ein Recht, sondern sogar eine Pflicht[,] und zwar eine ihrer heiligsten Pflichten. Sollte aber der Angreifer im Recht sein, so ist man nicht befugt, ihm Gewalt entgegenzusetzen, und die Verteidigung wird in diesem Falle ungerecht. Denn dieser Feind übt nur sein Recht aus. Er hat zu den Waffen gegriffen, um sich die ihm verwehrte Gerechtigkeit zu verschaffen, und es ist ungerecht, sich jemandem zu widersetzen, der von seinem Recht Gebrauch macht.27
Dieser Umstand hat eine wichtige Konsequenz: Er macht es erforderlich, darüber nachzudenken, ob es Bedingungen gibt, unter denen ein Angriffskrieg womöglich als legitim angesehen werden kann. Wer dies verneint, muss jeden Krieg, durch den sich ein Staat oder eine andere Kollektivperson gegen einen Angriff verteidigt, für legitim erachten. Wenn es nämlich keine Bedingungen gibt, unter denen ein Angriffskrieg als legitim erachtet werden könnte, dann kann es prinzipiell keinen illegitimen Selbstverteidigungskrieg geben.
Dies würde zum Beispiel bedeuten, dass wir einem Staat, der einen Teil der Bevölkerung des von ihm in Anspruch genommenen Staatsgebiets zu vernichten sucht, das moralische Recht zusprechen müssten, sich gegen jedweden Angriff eines Anrainerstaates zu verteidigen, der dem von der Vernichtung bedrohten Bevölkerungsteil mit militärischen Mitteln zu Hilfe kommt. Die wenigsten Menschen dürften dazu bereit sein, diese Konsequenz zu ziehen. Die meisten dürften vielmehr der Auffassung den Vorzug geben, dass es Bedingungen gibt, die einen Angriffskrieg zu legitimieren vermögen. Welche Bedingungen könnten dies aber sein?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Gibt es einen gerechten Krieg?»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gibt es einen gerechten Krieg?» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Gibt es einen gerechten Krieg?» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.