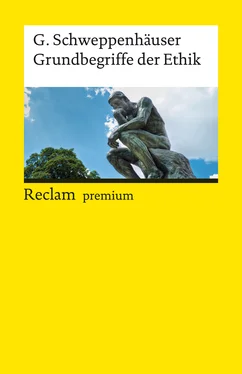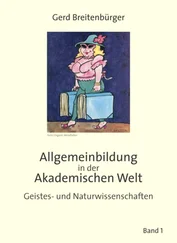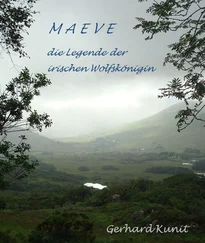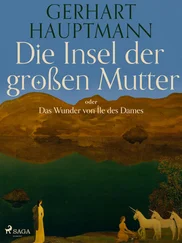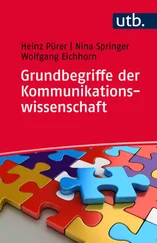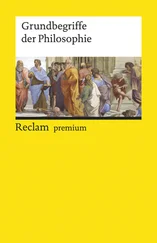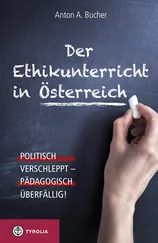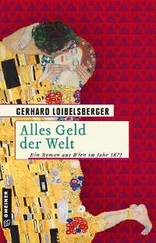Natürlich fordert dieses Szenario den Unwillen der Lesenden heraus. Doch es ist üblich, derartige Beispiele an den Haaren herbeizuziehen; wenn es um die Konstruktion von Argumentationsanlässen geht, ist der Maßstab nicht literarischer Realismus. Mit einer ähnlich konstruierten Situation hat Philippa Foot Ende der 1970er Jahre die Philosophiegeschichte bereichert. Hier wird eine Person adressiert, die einen Straßenbahnwagen steuert:
Der Trolley steuert durch eine Kurve, und auf der Spur vor Ihnen sehen Sie fünf Gleisarbeiter, die mit der Reparatur des Gleisstücks beschäftigt sind. Das Gleis führt an dieser Stelle durch ein kleines Tal mit steilen Hängen auf beiden Seiten, so dass Sie den Trolley stoppen müssen, wenn Sie die fünf Gleisarbeiter nicht überfahren wollen. Sie treten auf die Bremse, doch leider funktioniert diese nicht. Dann erkennen Sie plötzlich, dass ein Gleis nach [70]rechts abzweigt. Sie können den Trolley auf dieses Gleis umlenken und so die fünf Gleisarbeiter auf dem geraden Gleis […] retten. Leider hat Frau Foot den Fall so eingerichtet, dass sich auf diesem Gleis ein Gleisarbeiter befindet. Wie die fünf Gleisarbeiter würde es auch dieser Gleisarbeiter nicht rechtzeitig schaffen, sich vom Gleis zu entfernen, so dass Sie ihn töten werden, wenn Sie den Trolley auf ihn zusteuern. Ist es moralisch zulässig, dass Sie den Trolley umlenken? (Thomson 2020, 7.)
Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings, dass Situationsbeschreibungen, die derart konstruiert werden, um die Begründungen von Entscheidungen in problematischen Situationen herauspräparieren zu können, implizit ein ideologisches Menschenbild unterstellen, nämlich das die Konkurrenzgesellschaft prägende Bild. Der homo oeconomicus wählt gemäß rationaler Prüfung die Handlung, die ihm zum Vorteil gereicht, er ist jedoch auch in der Lage, von seinem vernünftigen Eigeninteresse zu abstrahieren. Es handelt sich um Hobbes’ Modell des Menschen. Ein klassisches Beispiel liefert das Dilemma im Rettungsboot: Drei Menschen befinden sich darin, obwohl nur Platz für zwei ist. Entweder wird einer geopfert oder alle werden untergehen. Wie entscheiden? Wie begründen? Das Beispiel ist typischerweise so konstruiert, dass der ›Konkurrenzkampf‹ ums Überleben nicht in Frage gestellt werden kann, sondern wie eine Naturgegebenheit erscheint. Dem Glück der größten Zahl ist das Glück der Einzelnen dann gegebenenfalls zu opfern. In »ausgeklügelten Problemfällen der Art, ob man eine Weiche umstellen dürfe, damit eine führerlose Straßenbahn nicht fünf, sondern nur einen Menschen [71]überfahren wird«, bemerkt der Philosoph Hans-Ernst Schiller, betreiben derartige utilitaristische Gedankenspiele »die Aufweichung des Grundsatzes einer Ethik, die über der des Interessenausgleichs steht, der Ethik der Würde oder des Menschen als Zwecks an sich« (Schiller 2011, 14 f.). Ähnliches gilt für das Dilemma, in dem ein entführtes Passagierflugzeug von der Ordnungsmacht abgeschossen werden müsste, damit die Entführer es nicht als bemanntes Geschoss in ein Atomkraftwerk oder ein vollbesetztes Fußballstadion steuern. »Wer nach Regeln für solche Fälle sucht, ist schon dabei, sie zu normalisieren« (15), kommentiert Schiller treffend. – Virulent wird in Pandemiezeiten die Frage nach Triage bzw. der Aufteilung von begrenzten, lebensrettenden Gütern auf zu viele Bedürftige: Wer soll das Beatmungsgerät bekommen?
Doch lassen wir die notwendige (Ideologie-)Kritik an dieser Art der Beispielbildung noch einen Augenblick außen vor. – Nehmen wir an, die Autofahrerin aus dem Ausgangsbeispiel findet kein Netz für ihr Mobiltelefon, verfügt aber über Ortskenntnis und einen Kleinwagen, der die Möglichkeit bietet, zwei Verletzte zu transportieren. Sie weiß, dass sich im nächsten Ort ein Krankenhaus mit Notaufnahme befindet. Dorthin könnte sie zwei Verletzte mitnehmen. Wen wird sie auswählen? Frauen und Kinder zuerst? Oder vielleicht die Dogge? Es kommt an dieser Stelle nur auf die triviale Feststellung an, dass die Überlegungen der hilfsbereiten Autofahrerin in so einem (unwahrscheinlichen) Fall (höchstwahrscheinlich) von Gesichtspunkten verschiedenster Art geleitet werden, die aber alle mit Erkenntnisakten zu tun haben. Wie schwer sind die Verletzungen? Nach welchen Kriterien würde die Autofahrerin [72]entscheiden, wer dringender sofortiger Hilfe bedarf als andere? Von welchen Annahmen wird sie sich leiten lassen?
Man darf annehmen, dass dabei neben affektiven oder emotionalen Gesichtspunkten auch Gesichtspunkte kognitiver Art im Spiel sind. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich jemand in einer derartigen Situation tatsächlich von kognitiven Überlegungen leiten lässt, anstatt nur emotional zu reagieren bzw. allgemeinen Konventionen oder persönlichen Neigungen und Idiosynkrasien zu folgen, ist nebensächlich. Es kommt darauf an, dass Handlungsentscheidungen, die von moralischer Relevanz sind, stets bis zu einem gewissen Grad kognitive Grundlagen haben. Hiermit ist nicht nur die Einschätzung empirischer Einzelfälle gemeint (zum Beispiel in Bezug auf die Schwere der Verletzungen), sondern die Art des moralischen Urteilens. Angefangen bei der Entscheidung ›Anhalten oder Weiterfahren‹, über den Entschluss zum Handeln und die einzelnen Handlungsentscheidungen bis hin zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Graden der Würde verschiedenartiger Lebewesen: Das sind alles Erkenntnisakte.
Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen einer Common-Sense-Überlegung und kognitiven bzw. rationalen Überlegungen. Erstere kommen ohne Verstandesargumente und Vernunftschlüsse zu Entscheidungen, die mit Hilfe von Erfahrungswissen und intuitiven Vorstellungen von der Lebensrelevanz der Handlungsmöglichkeiten operieren. Kognitiv-rationale Abwägungen sind anderer Art: Sie zielen auf die Frage, was getan werden sollte, also auf normative Universalisierung als Moralkriterium.
Ungeachtet der Künstlichkeit, Trivialität und Ideologieanfälligkeit des Beispiels geht es hier um die Illustration des [73]allgemeinen Satzes, dass wir uns in Konfliktfällen mit moralischer Bedeutung gemeinhin an Kriterien orientieren, die mit unseren Vorstellungen von Menschenwürde zu tun haben, aber auch mit Wertpräferenzen. Beides bestimmt unser Handeln in der Regel als eine komplexe Mischung aus heteronomen Sozialisationsfolgen und autonomen Überlegungen. Die neuere psychologisch-kognitive Moralforschung hat herausgefunden, dass diese komplexe Mischung ontogenetisch (beim Einzelnen) in gewisser Weise wiederholt, was sich phylogenetisch (stammes- oder besser: kulturgeschichtlich) als moralphilosophische Überlieferung durchgesetzt hat.
Berühmt ist das Dilemma, das der Moralpsychologe Lawrence Kohlberg bei seinen Untersuchungen, nach welchen Gesetzen sich die moralische Urteilsweise beim einzelnen Menschen entwickelt, in den 1970er Jahren heranwachsenden Proband*innen vorlegte: Heinz’ Frau ist todkrank. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, ist unbezahlbar. Der Apotheker ist nicht bereit, es Heinz umsonst oder für wenig Geld zu überlassen. Was wird Heinz tun? In die Apotheke einbrechen, um das Medikament zu stehlen? Oder sich dem Schicksal fügen und seine Frau sterben lassen? Wird er das Gesetz brechen oder das Gebot der Hilfeleistung missachten?
Unabhängig davon, wie sich Heinz entscheiden wird: Sofern er nicht einfach impulsiv handelt (dann würde er sich nicht in einem Dilemma befinden, zumindest nicht bewusst), wird er rationale Überlegungen anstellen müssen. Er wird abwägen, Prinzipien gegeneinanderstellen. Was hat den Vorrang: Ein allgemeingültiges Gesetz? Die Nähe zu einem Familienmitglied? Eine verallgemeinerbare Norm, [74]die Menschenleben als höheren Wert über Gesetzestreue stellt, oder das Leid von unvertretbaren Einzelnen?
Hier zeigt sich wirklich ein Dilemma. Der Ausdruck wird in der Alltagssprache gern dann verwendet, wenn es um schwierige Entscheidungen geht. Doch im philosophischen Sinn befindet man sich nur dann in einem Dilemma, wenn man sich zwischen zwei konträren, einander ausschließenden Handlungsmöglichkeiten entscheiden muss, deren Folgen man beide Male nicht wollen kann.
Читать дальше