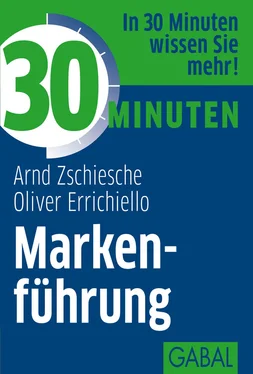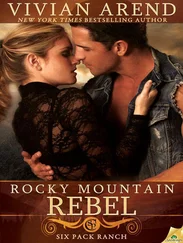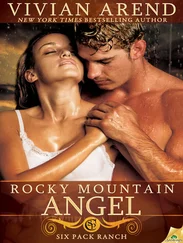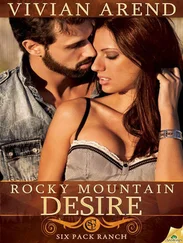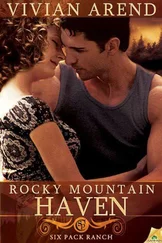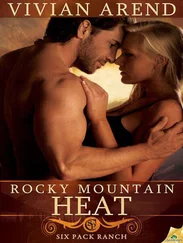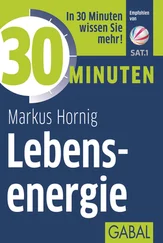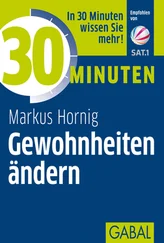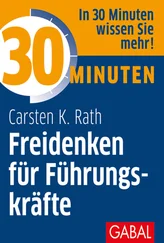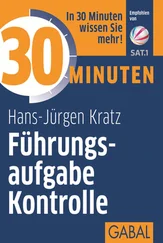Gute Leistungen schaffen positive Vorurteile
Dieser soziale Vorgang ist entscheidend für die Markenbildung: Eine gute Markenleistung sorgt dafür, dass sich ein positives Vorurteil bildet. Menschen haben ein Produkt gekauft oder einen Service in Anspruch genommen und waren mit der Leistung zufrieden. So zufrieden, dass sie wiederholt zugegriffen haben und wiederholt nicht enttäuscht wurden. Die Folge: Eine Anzahl Menschen redet positiv über eine Leistung und tätigt voller Erwartung den nächsten Kauf. Jede Marke funktioniert über ein solches Voraus-Urteil. Auch ein Zwischenhändler, der öffentlich gar nicht in Erscheinung tritt, existiert nur, weil seine Handelspartner ein positives Vorurteil über seine Leistung besitzen.
Positive Vorurteile lenken den Alltag
Jeden Tag können wir Einfluss und Lenkkraft der Marken-Vorurteile an uns selbst überprüfen: Auch wenn wir weder Dermatologe noch Chemiker sind, gehen wir fest davon aus, dass in der blauen Niveadose keine bösartigen Stoffe darauf warten, unsere Haut zu zersetzen. Unbedenklich konsumieren wir Produkte, greifen im Supermarkt nach Danone-Joghurt oder dem Saft von hohes C. Marken schenken Vertrauen und reduzieren somit die Komplexität des modernen Alltags. Eine dankbare Aufgabe: Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto kaufen, wissen aber rein gar nichts über Automarken. Rolls-Royce, Peugeot oder Dacia? Die Recherche wäre so umfangreich, dass bis zur Kaufentscheidung nur noch Raumgleiter über dem Boden schweben.
Positive Vorurteile als Fundament der Marke
Die Tatsache, dass negative Vorurteile extrem widerstandsfähig sind, hat unzählige Tragödien begünstigt. Oft wird daher die schiere Unüberwindbarkeit von negativen Vorurteilen beklagt. Kostspielige Aufklärungskampagnen verlaufen im Sand, weil Vorurteile kulturell tief verankert sein können. Albert Einstein stellt dazu fest: „Ein Vorurteil ist schwerer zu spalten als ein Atom.“ Für Marken ist die Widerstandskraft von Vorurteilen dagegen ein wirtschaftlicher Segen: Denn positive Vorurteile sind ebenso schwer spaltbar und langlebig wie negative. Das bedeutet, dass eine Marke, der es gelungen ist, ein positives Vorurteil zu etablieren, schon einiges „leisten“ muss, um das gute Urteil zu attackieren: Es braucht einen medial ausgeschlachteten Schleudertest, um das positive Vorurteil über die Sicherheit eines Mercedes-Pkw zum Wackeln zu bringen. Der Begriff „Elchtest“ wird noch über Jahrzehnte hinweg negativ mit Mercedes in Verbindung gebracht werden und VW wird über lange Zeit mit „Dieselgate“ zu kämpfen haben – egal wie akkurat danach gearbeitet wurde. Als volumenstärkster Autobauer der Welt, einst weltberühmt für die Solidität und Zuverlässigkeit seiner Produkte wird VW seit 2017 mit ganz anderen „(Negativ-) Leistungen“ in Verbindung gebracht. Bedenken Sie: Auch wenn Ihre Firma deutlich kleiner und jünger als der Wolfsburger Konzern ist, der Mechanismus wirkt immer auf die gleiche Weise!
Marke bedeutet Verpflichtung
Es ist deutlich erkennbar, warum sämtliche Energien eines Unternehmens darauf gerichtet werden müssen, das positive Vorurteil zu erhalten und es jeden Tag neu zu bestätigen: Vorurteile sind der Beton, auf dem Marken stehen, und dürfen nie ins Wanken geraten. Ihre Existenz schränkt jedoch die Optionen der Verantwortlichen ein: Von dem Moment an, in dem ein positives Vorurteil über die Marke existiert, ist das Unternehmen dahinter in seinem Handeln nicht mehr frei. Ab diesem Zeitpunkt hat es die Verpflichtung, immer genau so zu agieren, dass die Erwartungshaltung der Kundschaft bestätigt wird. Juristisch gesehen besitzt ein Unternehmen „seine“ Marke. Doch sobald ein solides Vorurteil existiert, gehört sie der Kundschaft: Diese trägt das Wissen und das Bild von der Marke – und sie zahlt dafür.
| Eine Marke ist ein positives Vorurteil über eine Leistung. Menschen haben über ihre gute Erfahrung mit einer Leistung Vertrauen aufgebaut: Kundschaft ist entstanden. Wichtigste Aufgabe des Unternehmens ist es, dieses Vorurteil und damit das Vertrauen in die Markenleistung konsequent zu bestätigen . |
 |
1.2Eine Marke lebt von Wiederholung
Vertrauen kann nur entstehen, wenn das Gegenüber verlässliche Signale sendet. Grundlage für den Aufbau eines positiven Vorurteils ist die regelmäßige Wiederholung eines Vorgangs. Jemand, den ich am Montag mit Punkfrisur und Fetzenjeans antreffe, der mir am Dienstag glatt gegelt im Anzug entgegentritt, ergibt kein klares Bild. Solch radikaler Wechsel mag für Privatmenschen spannend sein, für eine Marke bedeutet es die Gefährdung ihrer Integrität und somit der monetären Existenzgrundlage. Selbst die flippigste Modemarke besitzt bei genauer Analyse Strukturen, die sich wiederholen – keine wirtschaftliche Unternehmung kommt ohne feste Elemente aus. Auch eine „wilde“ Hardrockmarke wie die Gruppe AC/DC verfügt über Strukturen, die sich bei jedem Auftritt wiederholen müssen: Wenn z. B. Lead-Gitarrist Angus Young, der seit den 1970er-Jahren Konzerte nur in Schuluniform bestreitet, dieses markentypische Element nicht mehr tragen würde, wäre die „Fankundschaft“ bitter enttäuscht.
Erst Kontinuität gibt Orientierung
Entscheidendes Charakteristikum einer Marke ist, dass sie in einer scheinbar unüberschaubaren Welt Kontinuität verspricht. Eine Marke ist das Gegenteil von Wandel, sonst ist sie nicht(s): Daher besitzt eine Marke die Pflicht zur Kontinuität, um als Marke überhaupt erkennbar zu sein, d. h., sie muss immer und überall typisch auftreten. Nur auf diese Weise kann sie Orientierung schaffen und erfüllt die Ankerfunktion für ihre Kundschaft: Das positive Vorurteil muss ständig und an jedem Kontaktpunkt zur Marke Bestätigung erfahren; dies geschieht in starkem Maße über Wiederholung.
Wiederholung ist nicht Stillstand
Wiederholung gilt heutzutage als Synonym für Stagnation und Erstarrung. All dies sind Begrifflichkeiten, welche direkt mit langweilig, altmodisch, unzeitgemäß assoziiert werden und daher im Geschäftsleben umgehend ins verbale Aus führen. Dahinter steckt ein großes Missverständnis: Wiederholung bedeutet für eine Marke in keiner Weise Stillstand – auch die innovativste Technikmarke braucht Wiederholung: Egal welche Erfindung den Markt erobert oder vom Unternehmen selbst vorgestellt wird, es ist die Pflicht der Marke, jede Neuerung markentypisch zu integrieren. Oder, wenn sie nicht ins Markenportfolio passt, sie möglichst früh auszusortieren. Eine anspruchsvolle Aufgabe, der sich jede Firma tagtäglich stellen muss, wenn sie ein positives Vorurteil etablieren möchte. Bei jeder Neuheit gilt es abzuwägen, ob und wie diese integriert werden kann. Das funktioniert am effizientesten, wenn zuvor definiert wurde, welche konkreten Erfolgsfaktoren konstituierend für die Marke sind.
Der höchste Lohn: das Vertrauen der Kundschaft
Als Dank für die konstante Wiederholung und typische Interpretation von Leistung erhält das Unternehmen die nachhaltigste Belohnung überhaupt: das Vertrauen der Kundschaft und die entscheidende Auswirkung davon – einen quasi automatisierten Einkaufsvorgang. Der Kunde weiß, er kann sich blind auf „seine“ Marke verlassen, sein Alltag wird an einem Punkt entlastet, er dankt es mit Treue. Solange die Marke ihm alles in gewohnter Qualität und Form zur Verfügung stellt, wird er über kein Konkurrenzangebot nachdenken. Der gern als Angstgespenst konstruierte Kunde, der jeden Tag alle Anbieter vergleicht, um sich minütlich neu für den billigsten zu entscheiden, ist ein Hirngespinst: Ein durchschnittlicher deutscher Haushalt kauft pro Jahr 466 verschiedene Artikel – 80 Prozent davon befanden sich bereits im Vorjahr im Einkaufswagen. Der Mensch ist immer ein Gewohnheitstier gewesen und wird es immer sein – Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, aber von Ausnahmen kann keine Firma leben. Das mag der aufgeklärte Einzelne bedauern, aber es ist der Grund, warum eine Marke funktioniert und existiert. Und es ist ein Grund, warum die Marke in erster Linie ein soziologisches Phänomen ist.
Читать дальше