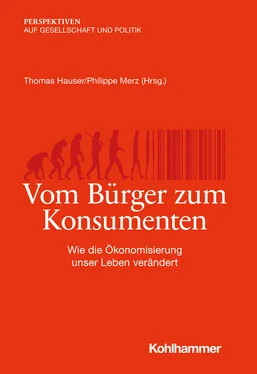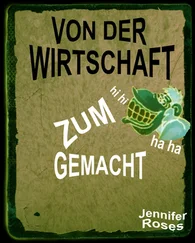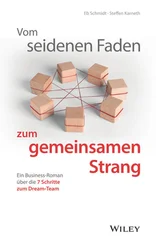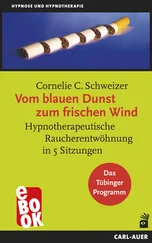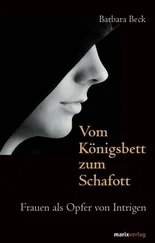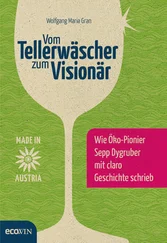Cloud-Anwendungen sind ein weiteres zentrales Infrastrukturelement. Sie ermöglichen die fortschreitende Integration des jeweiligen Produkt- und Dienstleistungsportfolios durch die Sicherung und Expansion von Informationskontrolle. In den Rechenzentren der Leitunternehmen werden sämtliche marktrelevanten Daten der Nutzer:innen gespeichert und verwertet. Kein digitales Ökosystem funktioniert heute ohne diese im Hintergrund laufende Infrastruktur. Dass immer mehr Unternehmen, aber auch staatliche und andere Institutionen auf sie angewiesen sind, zeigt sich etwa am schier unglaublichen Bedeutungszuwachs des führenden Cloud-Anbieters Amazon Web Services (AWS), der derzeit einen Anteil von über 30 % am globalen Cloud-Markt hält (andere Leitunternehmen wie Microsoft, Google und Alibaba folgen auf den Plätzen). Die Liste der Unternehmen und Organisationen, die AWS nutzen, verdeutlicht, wie zentral die Amazon-Cloud für die digitale Weltinfrastruktur ist. Laut Amazon zählen zu den über eine Million Anwendern nicht nur prominente »Old Economy«-Unternehmen wie Kelloggs, Unilever, Volkswagen und BMW, sondern auch die Nasa, die Uno oder das US-Verteidigungsministerium.
Insbesondere für andere Digitalunternehmen ist AWS heute überlebenswichtig. Zu den Kunden aus diesem Feld zählen das deutsche Unternehmenssoftware-Powerhouse SAP, die Flatsharing-Plattform Airbnb und der Videostreaming-Dienst Netflix, der seinen gesamten Traffic über AWS abwickelt. Wie bedeutend die private Infrastruktur von Amazon mittlerweile für das gesamte kommerzielle Internet ist, wurde den US-Bürgern am 8. Februar 2017 deutlich, als Services wie Netflix, Spotify, Tinder, Dropbox und Tausende andere für ihre Nutzer:innen vier Stunden lang nicht erreichbar waren. Was war passiert? Ein AWS-Mitarbeiter hatte sich »vertippt« und aus Versehen mehr Server offline genommen als geplant. Seither spricht man von diesem Datum als jenem Tag, an dem »das Internet offline ging« – genauso richtig wäre es zu sagen, dass für vier Stunden ein Großteil des Marktes verschwand.
Auch das Zauberwort »künstliche Intelligenz« (KI) wird ein Stück greifbarer, wenn man sich deren Verwendung durch die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus ansieht. Der Begriff »KI« ist heute im öffentlichen Diskurs mit zwei unterschiedlich umfassenden Bedeutungen anzutreffen: erstens als Metapher für die fortschreitende Vernetzung von Dingen und Prozessen durch Algorithmen, wodurch beinahe jede Programmiertätigkeit irgendwie zu diesem Komplex gehört; zweitens spricht man in einem engeren Sinne von KI, wo es um Prozesse des maschinellen Lernens geht. Mit maschinellem Lernen ist gemeint, dass Algorithmen relativ selbstständig große Datensätze (Big Data) nach Mustern (Korrelationen) durchsuchen und aus den Ergebnissen Handlungsimplikationen ableiten. Big Data bildet die notwendige Basis dieser Technologie und die Herrscher über die großen Datensätze sind die Leitunternehmen im Bereich KI. Entsprechend hat die öffentliche Beunruhigung über KI viel mit dem Szenario zu tun, dass die Konzerne als Avantgarde der technologischen Entwicklung diese neue Grundlagentechnologie unter ihre exklusive Kontrolle bringen könnten.
In den Forschungsabteilungen und Datenzentren der Leitunternehmen wird tatsächlich in KI-fähige Infrastruktur investiert, da Rechenpower und KI systematisch zusammenhängen. Jenseits des Aufbaus von Server-Kapazitäten investieren die Leitunternehmen dabei zunehmend auch in die Entwicklung eigener KI-Chips. Ziel dieser Expansion im Feld der Infrastruktur ist nicht nur die Einführung einer neuen Produktkategorie oder -komponente – selbst wenn dies selbstverständlich eine wichtige Rolle spielt. Vielmehr geht es auch um die sukzessive Schließung der proprietären Märkte, indem eine weitere Schnittstelle zu den Konsument:innen besetzt wird. Immer größere Teile der Rest-Ökonomie sollen auf diesem Weg in Abhängigkeit zu den Meta-Plattformen geraten.
Auf der Konsument:innenseite zeigt sich diese Entwicklung vor allem mit Blick auf die ganz konkreten Verwendungsweisen von KI. So kommen bislang vor allem Sprach- und Interaktionsassistenzprogramme zum Einsatz, die das Marktprofil der Leitunternehmen abrunden und erweitern. Diese »Kontaktvereinfacher« sollen es Konsument:innen noch leichter machen, auf den proprietären Märkten zu agieren. Man arbeitet an der Beseitigung eines der letzten Vorteile des stationären Handels: der sprachlich vermittelten Interaktion. In Form smarter Mikrofone wie der Echo-Linie von Amazon, des Apple-Homepod oder der Google-Home-Geräte rücken die Leitunternehmen noch näher an die potenzielle Kundschaft heran. Der Markt für diese Produkte ist in den vergangenen Jahren insbesondere in den USA geradezu explodiert: Die Smart-Speaker-Absätze haben sich dort allein von 2016 auf 2017 verdreifacht, im Frühjahr 2018 verfügte bereits jeder fünfte US-Haushalt über ein solches Gerät. Weltweit wurden im ersten Quartal 2018 über neun Millionen Speaker verkauft, was einem Wachstum von über 200 % im Vergleich zum Vorjahrsquartal entspricht.
Privatisierter Merkantilismus
Fragt man nach der analytischen Bedeutung der Formierung proprietärer Märkte, ist man weniger auf etwas vollkommen »Vorbildloses« (Zuboff 2019) als vielmehr auf etwas für die kapitalistische Ökonomie recht Ursprüngliches verwiesen. Mit den proprietären Märkten kehrt im Grunde eine Idee zurück, die die frühkapitalistische, vorliberale Epoche in Europa prägte. Basis des Merkantilismus jener Zeit war − anders als im (Neo-)Liberalismus − ein Verständnis des Welthandels als Nullsummenspiel. Dies zeigte sich insbesondere an der Bedeutung einer aktiven Handelsbilanz, die das zentrale Ziel des merkantilistischen Staates darstellte. Wohlstand war aus dieser Perspektive nur durch die Übervorteilung anderer Parteien zu erreichen. Positive Handelsbilanzen wurden den »gegnerischen Parteien« gerade im Rahmen des Imperialismus regelmäßig mit roher Gewalt abgepresst, etwa mithilfe staatlich garantierter und geschützter Handelsmonopole wie der britischen Ostindien-Kompanie, die von der englischen Krone unter anderem mit dem Recht ausgestattet worden war, eigene Truppen auszuheben.
Der große Unterschied zwischen dem im Entstehen begriffenen System proprietärer Märkte und dem klassischen Merkantilismus besteht dabei in der jeweiligen Rolle des Staates. Es war der Staat, der die Handelsmonopole förderte, weil er von deren Gewinnen profitierte. Die Trading Companies waren in dieser Hinsicht Monopole von Gnaden des absolutistischen Staates.
Die proprietären Märkte des kommerziellen Internets hingegen sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die in jüngerer Vergangenheit gerade für diverse demokratieschädigende Praktiken in die Kritik geraten sind: Steuervermeidung etwa oder die Beförderung einer Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit. Der Staat ist der große Verlierer dieser Entwicklung.
Wie der klassische Merkantilismus, der auf Handelsgewinne zielte, weil Produktivitätsgewinne kaum existierten, ist auch sein digitaler Wiedergänger ein Projekt für eine Welt ohne Wachstum. Im Zeichen der Stagnation des Gegenwartskapitalismus werden offenbar Geschäftsmodelle attraktiv, die auf das Abschöpfen von Renten durch Marktbesitz ausgerichtet sind. Der digitale Kapitalismus bricht in diesem Sinne mit jeder liberalen Spielart des Kapitalismus. Denn mit der Kontrolle des Marktes wird dieser als neutrale Instanz des Tausches praktisch abgeschafft.
Man kann in diesem Sinne vom kommerziellen Internet der Gegenwart als einem Ort sprechen, der von einer post-neoliberalen Praxis geprägt ist. Der Markt als neutrale Instanz des Tausches ist hier praktisch abgeschafft zugunsten eines privatisierten Systems datengestützter Profitextraktion.
Der privatisierte Merkantilismus der Leitunternehmen ist freilich in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus öffentlicher Kritik und politischer Regulierungsbestrebungen gerückt – gerade in Europa. Dabei sind es vor allem Zugriffe über das Kartellrecht, mit denen versucht wird, der Macht der Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus Grenzen zu setzen. Ziel ist es, den proprietären Märkten des kommerziellen Internets eine Neutralitätspflicht aufzuerlegen, indem beispielsweise Diskriminierungen gegen Wettbewerber unterbunden werden.
Читать дальше