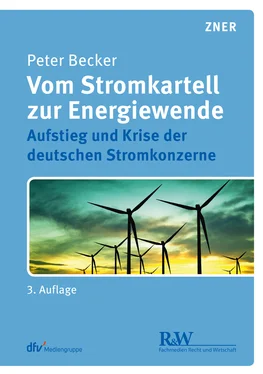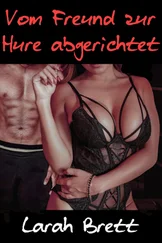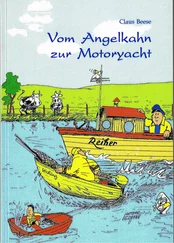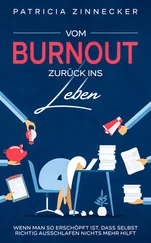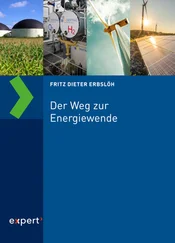Am 24.1.1884 billigte die Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit den Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Actiengesellschaft Städtische Elektricitätswerke. Übertragen wurde die Stromversorgung des Stadtbezirks rings um den Werderschen Markt (heute Sitz des Auswärtigen Amtes); nur wenige hundert Meter von der Prachtstraße Unter den Linden entfernt. Im Vertrag zwischen Stadt und EVU wurden jene Grundregeln festgelegt, die Konzessionsverträge bis zum Jahre 1998 aufwiesen, dem Jahr der Liberalisierung der Energiemärkte. Die Gesellschaft erhielt das exklusive Wegerecht für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; niemand außer der Gesellschaft konnte Stromleitungen verlegen. Das war ein Transportmonopol. Außerdem erhielt sie auch das Monopol für den Stromverkauf, weil sonst der hohe Investitionsaufwand für die Leitungen nicht zu finanzieren war. Als Gegenleistung zahlte Rathenau 6 % vom Umsatz als Konzessionsabgabe an die Stadt. Außerdem verpflichtete er sich, jeden Bürger im Konzessionsgebiet an das Netz anzuschließen – die „Anschluss- und Versorgungspflicht“. Der Stadt war auch schon klar, dass im Monopol die Preise kontrolliert werden mussten. Der Magistrat behielt sich also eine Preis- und Missbrauchsaufsicht für die Tarife vor.
Das gelungene Berliner Experiment war ein Signal für andere deutsche und europäische Städte. Das Berliner Beispiel wurde vielfach kopiert. Daraus ergaben sich für Rathenaus Firmen kräftige Wachstumsimpulse. Während die Deutsche Edison im Jahr 1886 nur rund 90.000 Glühlampen verkauft hatte – was damals ein gewaltiger Erfolg war –, wurden drei Jahre später schon mehr als 1 Million Glühlampen verkauft.
Strom wurde allerdings praktisch nur für Glühlampen gebraucht. Rathenau propagierte deswegen die Umrüstung der Industrie von Dampfkraft auf Elektrizität. In Berlin liefen um 1888 tagsüber nur etwa zwölf Elektromotoren. Rathenau stieg daher in Straßenbahnen ein: Er baute städtische Pferdebahnen in Rekordzeit zu einer elektrischen Straßenbahn um. Beispiel Halle: Das städtische Kraftwerk gewann tagsüber einen Großkunden, die „Elektrische“, die hohe Gewinne abwarf. Außerdem bezog sie das gesamte elektrische Material von Rathenau. Es kam zu einem „Straßenbahnfieber“: Breslau, Chemnitz, Dortmund, Essen, Fürth, Gladbach, Königsberg, Kiew und Oslo.
Rathenau gelang es auch, die gesamte Stromversorgung von Genua in einer einzigen Gesellschaft zusammenzufassen, der als Großverbraucher auch die Straßen- und Zahnradbahn in der Hafenstadt gehörten. Danach fielen auch Mailand, Venedig und Neapel an die AEG. In der Schweiz beteiligte sich Rathenau an einem Konsortium, das das Recht besaß, den Rheinfall von Schaffhausen für die Stromgewinnung zu nutzen. Er baute die Anlagen. Finanziert wurden die Aktionen aus der Schweiz, von einer Spezialbank in Zürich, bei deren Gründung Rathenau sich mit der Schweizerischen Kreditanstalt zusammengetan hatte: „Bank für elektrische Unternehmungen“, Elektrobank. Rathenau entdeckte schließlich Südamerika. Er gewann die Konzessionen für Kraftwerksbau und Stromversorgung von Buenos Aires (Argentinien), Santiago de Chile und Montevideo (Uruguay).
Der Konzessionsvertrag garantierte mit seinen langen Laufzeiten dem Stromversorger Investitionssicherheit und ein Versorgungsmonopol, der Kommune die Erfüllung der Gemeinwohlaufgabe Elektrizitätsversorgung. Erst 1990 wurde mit einer Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) die Laufzeit auf zwanzig Jahre beschränkt. Und erst 1998 erzwang die EU mit dem „third party access“ den Wettbewerb in der Stromversorgung: Wettbewerber können den Zugang zum Netz verlangen. Der Konzessionsvertrag vermittelt nur noch ein Wegenutzungsrecht – und das nicht einmal autonom. Denn (etwa) Industrieunternehmen können von der Kommune ein Wegerecht für den Bau einer Direktleitung verlangen.
3. Kapitel
Die Großbanken wittern das große Geschäft
Rathenaus kleine Berliner Zentralstationen produzierten allerdings außerordentlich teuer; die Kilowattstunde kostete 1 Goldmark. Die Bankiers, die Rathenaus Firmengründungen finanziert hatten, saßen auf unverkäuflichen Aktien. Zwar konnte das erste öffentliche Kraftwerk 6.000 Lampen mit Strom versorgen, tatsächlich am Netz waren aber nur 3.000, und zwar fast ausschließlich in Theatern, Hotels und Banken. Nicht einmal der alte Kaiser hatte elektrisches Licht. Deswegen verlangten die Bankiers drastische Sparmaßnahmen. Die Finanzierung zweier weiterer Kraftwerke in der Innenstadt, die der Magistrat forderte, lehnten sie ab.
Rathenau hielt das für einen schweren Fehler. Er wollte im Gegenteil kräftig expandieren und dazu große Dynamos einsetzen. Die Bankiers hielten ihm entgegen: „ Wenn Sie mit kleinen Maschinen schon keinen Profit machen können, wieviel weniger mit großen! “ Der Magistrat drohte andererseits, die Konzession zu kündigen, wenn die geforderten Kraftwerke nicht gebaut würden. Da kam Rathenau Georg Siemens zu Hilfe, ein Vetter von Werner Siemens, der sich in der Elektrizitätsbranche bestens auskannte. Er war der Gründer und Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Dabei stand er in regem Austausch mit dem US-Banker John Pierpont Morgan, dem Finanzier von Edison. Siemens beurteilte die Lage daher anders als die Bankiers, die hinter Rathenau standen. Die Finanzwirtschaft konnte sich mit ihren Krediten direkt an das Wachstum der Elektroindustrie und der Stromwirtschaft ankoppeln, die sich nach dem Berliner Vorbild bald über das ganze Reich ausdehnen würden. Georg Siemens war daher bereit, Rathenaus Gesellschaften die geforderten Kredite zu geben. Mit diesem „Sprung in die Elektrizitätswirtschaft“ stiftete der Sprecher der Deutschen Bank die „Ehe zwischen Großbanken und Stromern“, die heute noch funktioniert.
Während J.P. Morgan und David Rockefeller in den USA straff organisierte Dachgesellschaften (Trusts) propagierten, zeigte sich Werner Siemens eher ablehnend. Georg Siemens hingegen bewunderte seine amerikanischen Vorbilder: „ Die Leute sind rücksichtslose Räuber, aber sie haben Sinn für große Konstruktionen! “ Die Deutsche Bank beschloss daher auf Vorschlag von Georg Siemens, „ sich mit ihrem Namen, ihrer Arbeit und mit ihrer Kapitalkraft an der Sicherung und Erweiterung der Deutschen Edison-Gesellschaft und ihrer vorbereiteten Unternehmungen zu beteiligen “. Nach amerikanischem Vorbild setzte Georg Siemens die Deutsche Edison und die Firma Siemens & Halske unter Druck, einen neuen Kartellvertrag zu schließen. Danach durfte Rathenau jetzt auch große Dynamos bis zu 100 PS fabrizieren; bei größeren Kraftwerken aber „ sollte die Bauausführung gemeinschaftlich erfolgen “. Siemens hatte damit ein Standbein im Kraftwerkbau und beteiligte sich mit 1 Million am Aktienkapital der Rathenau-Firma. Sein Sohn Arnold wurde Aufsichtsratsmitglied.
Mit dem frischen Geld wurden Edison zunächst die Patentrechte abgekauft. Außerdem gab es Rathenau Gelegenheit, seine Selbständigkeit auch im Firmennamen zu zeigen: Er taufte die Deutsche Edison in Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) um. In den nächsten zwölf Jahren brachte Rathenau die AEG von wenigen Hundert auf fast 20.000 Mitarbeiter. Auch die Berliner Elektricitätswerke AG wurde zur Goldgrube: Rathenau erhielt von Georg Siemens statt der von ihm geforderten drei von den anlagefreudigen Banken in den nächsten vier Jahren 30 Mio., die er in den Bau von Großmaschinen investierte. Die Aufträge kommentierte Werner Siemens wie folgt: „ Bauen kann ich Ihnen solche Maschinen schon, aber gehen werden sie nicht. “ Das war eine Fehleinschätzung. Vielmehr wurden die Maschinen zum Verkaufsschlager des Jahrzehnts, zum „ Goldesel der Firma Siemens & Halske “. Der Erfolg der AEG zeigte sich auch daran, dass Rathenau seinen Aktionären bis 1914 eine Dividende von 15 % p.a. zahlte.
Читать дальше