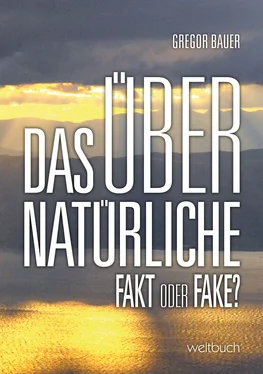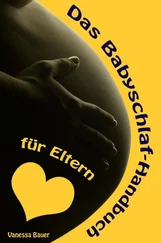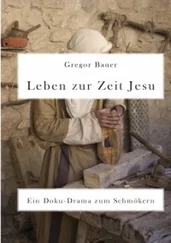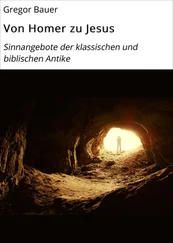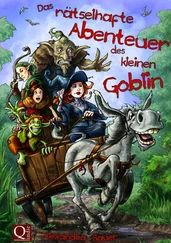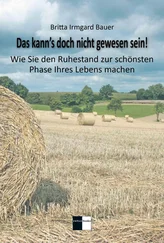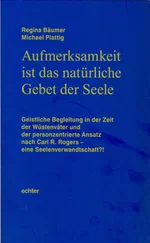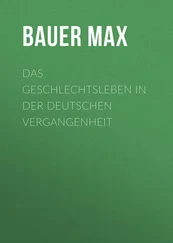Naturwissenschaft als Segen und Alptraum:Niemand will auf Naturwissenschaft und Technik verzichten. Aber durch sie sind wir auch bedroht von Atomwaffen, Klimawandel, Artensterben, digitaler Überwachung, Genmanipulation und Künstlicher Intelligenz. Dürfen wir den Wissenschaftlern noch vertrauen? Müssen wir ihrem Einfluss Grenzen setzen? Auch ihrem Einfluss auf unsere Glaubensentscheidungen?
Theologie:Sind Evolutionstheorie und der Glaube an ein ewiges Leben Gegensätze? Nein, sagen moderne Theologinnen. Sie halten die Naturwissenschaften und die Religion für vereinbar. Das meint auch Hans Küng (*1928), einer der meistgelesenen Theologen der Gegenwart. Wie argumentiert er? Und was bleibt von der transzendenten Dimension, wenn man das heutige naturwissenschaftliche Weltbild uneingeschränkt akzeptiert?
Parapsychologie:Wenn eine Weltanschauung so selbstsicher auftritt wie die naturwissenschaftliche, dann liegt die Frage nahe: Gibt es Phänomene, die mit diesem Weltbild in Widerspruch stehen, sei es tatsächlich oder scheinbar? Parapsychologen arbeiten daran, solche Phänomene aufzuspüren. Was ist ihnen bisher gelungen? Wie reagieren anerkannte Wissenschaftler darauf? Und wie verhalten sich parapsychologische Forschung und religiöse Wunder zueinander?
Nahtoderfahrungen:Viele Menschen machen an der Grenze zum Tod tiefe seelische Erfahrungen. Danach ist für sie nichts mehr wie zuvor: Materielle Ziele werden unwichtig, die Liebe wird zum zentralen Lebensinhalt, und an einem Leben nach dem Tod gibt es für diese Menschen keinen Zweifel mehr. Wie begründen sie ihre Zuversicht? Und was sagt dazu ihre schärfste Gegnerin, die Ex-Parapsychologin Susan Blackmore?
Tod:Was bleibt von all unseren Argumenten für oder gegen den Glauben an Gott, wenn wir eines Tages im Sterben liegen? Werden wir dann immer noch sicher sein, was danach kommt – sei es, dass uns das erlösende Nichts erwartet, sei es, dass unsere Seele weiterlebt? Natürlich können wir das vorher nicht wissen. Aber ich möchte Ihnen doch weitergeben, was mir Hospiz-Mitarbeiterinnen dazu gesagt haben, die schon viele Menschen in ihren letzten Tagen und Stunden begleitet haben. Und ich stelle Ihnen Christopher Hitchens (1949–2011) vor. Der Autor hat, schwer an Krebs erkrankt, bis kurz vor seinem Tod geschrieben und ist bis zuletzt ein Atheist geblieben.
Was erwartet Sie in diesem Buch nicht?
Nicht beschäftigen werde ich mich mit Atheisten, die gegen einen Gott vor allem moralisch argumentieren, wie Friedrich Nietzsche (1844–1900) oder Albert Camus (1913–1960). Denn uns interessiert hier weniger, ob Gott etwas vorzuwerfen sei, sondern ob Gott – oder wie immer wir das Transzendente nennen wollen – tatsächlich existiert.
Beiseite lasse ich auch Atheisten, die die Religion pathologisieren, also als etwas Krankhaftes betrachten, wie Ludwig Feuerbach (1804–1872), Karl Marx (1818–1883) oder Sigmund Freud (1856–1939). Denn auch sie tragen wenig zu der Frage bei, die uns hier vor allem beschäftigt: ob es eine transzendente Wirklichkeit gibt oder nicht.
Nicht eingehen werde ich auch auf die spezifischen Vorstellungen der verschiedenen Religionen. Was die christlichen Kirchen voneinander unterscheidet, warum Muslime den Ramadan begehen oder welche buddhistischen Schulen es gibt: All das wird uns hier nicht beschäftigen.
Ich konzentriere mich auf das, was die Transzendenz-Gläubigen gemeinsam haben, und auf das, was die Naturalisten dagegen einzuwenden haben.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Gregor Bauer
Düren, im April 2021
2 .
Wissenschaftsgeschichte:
Was haben Naturwissenschaft und Religion einander angetan?
„Engel haben an der Universität nichts zu suchen.“ So hat mein Philosophie-Professor klargestellt, was er davon hält, wenn die Religion Einfluss nehmen will auf die Wissenschaft: nichts.
Und dafür hat er gute Gründe, wie die Geschichte der Naturwissenschaften zeigt. Hat die Religion der Wissenschaft nicht lang genug Knüppel zwischen die Beine geworfen? Waren es nicht die Mythen der Frommen, die der Einsicht in die Naturgesetze im Weg standen? Hat sich der Glaube an einen Schöpfergott und Unsterblichkeit nicht mit Evolutionstheorie und Hirnforschung erledigt?
Dieser Eindruck liegt nahe. Aber seien wir nicht voreilig: Wie wir das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion sehen, ist auch eine Frage der Perspektive. Deshalb möchte ich die Geschichte der Naturwissenschaften zweimal knapp skizzieren, von gegensätzlichen Standpunkten aus.
Zur Skizze 1: Hier orientiere ich mich vor allem an:
•Lars Jaeger (2015): Die Naturwissenschaften. Eine Biographie
Jaeger (*1969), Physiker und Unternehmer, ist ziemlich sauer auf die Kirche, weil sie seinen Kollegen immer wieder das Leben schwer gemacht hat. Für ihn als Naturalist ist klar: Religion ist als vorwissenschaftliches Denken zu überwinden und durch Wissenschaft zu ersetzen.
Wie alt ist der Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion?
Die Geschichte der Naturwissenschaften konnte, so Jaeger, überhaupt erst beginnen, als Menschen zum ersten Mal religiöse Mythen als Erklärung für natürliche Vorgänge ausschlossen. So gesehen, war Anti-Religiosität von Anfang an ein Merkmal der Naturwissenschaften.
Die frühesten Überlieferungen einer solchen Geisteshaltung stammen aus der „Achsenzeit“: So bezeichnete der Philosoph Karl Jaspers (1883–1969) die Zeitspanne von etwa 800 bis 200 vor Christus. Damals wurden in China, Indien, Palästina, Persien und Griechenland die geistigen Grundlagen gelegt, die die Menschheit heute noch prägen. Für das Verhältnis von Religion und Wissenschaft besonders wichtig wurde die ionische Revolution der „Vorsokratiker“ in den griechischen Kolonien des sechsten Jahrhunderts.
Der erste von ihnen, Thales von Milet (ca. 624–547 v. Chr.), ist auch der erste, von dem wir wissen, dass er die Welt rational erklärte: Alles, was es gibt, führte er auf nur eine einzige Grundsubstanz zurück – auf Wasser. Weitere vorsokratische Entmythologisierer waren:
•Anaximander (ca. 610–545 v. Chr.). Er führte Gewitter nicht mehr auf einen blitzeschleudernden Zeus zurück, sondern erklärte sie als Folge platzender Druckluftwolken.
•Heraklit (ca. 544–484 v. Chr.) verachtete den überlieferten Volksglauben und hielt sich stattdessen an seine eigenen Sinne.
•Parmenides (ca. 540–470 v. Chr.) setzte radikal auf den bloßen Verstand.
•Demokrit (ca. 460 – ca. 370 v. Chr.) und sein Vorgänger Leukipp (5. Jh.) erklärten alles, was überhaupt existiert, mit unterschiedlich zusammengesetzten Atomen im leeren Raum.
Die Anhänger der Religion haben solche Auffassungen schon sehr früh als bedrohlich empfunden und erbittert bekämpft:
•Anaxagoras (ca. 500–428 v. Chr.) entging nur knapp der Hinrichtung. Sein Verbrechen: Er hatte behauptet, dass die Sonne nicht ein Gott sei, sondern ein glühender Steinhaufen.
•Sokrates (469–399 v. Chr.) wurde als Lehrer des kritischen Denkens zum Tod verurteilt.
•Aristoteles (384–322 v. Chr.) floh aus Athen, als er wegen angeblicher Gotteslästerung mit dem Todesurteil rechnen musste.
Wann war die erste Blütezeit von Wissenschaft und Technik?
Das wissenschaftliche Denken war jedoch nicht mehr aufzuhalten – jedenfalls zunächst nicht: Nach Aristoteles und bis ins späte zweite Jahrhundert nach Christus hinein kam es zu einer wahren Explosion des Wissens in der gesamten griechischsprachigen Welt, also von Sizilien über Südosteuropa, Kleinasien, Ägypten und Syrien bis ans Schwarze Meer.
Читать дальше