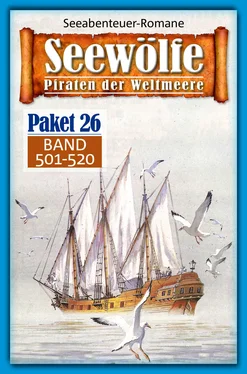Die Hafengegend war von unbeschreiblichem Lärm erfüllt. Der Gardist rannte mit langen Sätzen, hörte seine Schritte von den Hauswänden zurückhallen und sah die erhellten Eingänge der Schenken wie durch einen Schleier.
Überall quollen Menschen ins Freie. Abgerissene Gestalten, zerklüftete Gesichter, haßerfüllte Augen, ordinäre Dirnen, die Gemeinheiten von sich gaben. Dolche und Entermesser, die unverhohlen unter zerlumpten Umhängen hervorgezogen wurden und drohend im Lampenlicht blitzten.
Erste Flüche wurden ihm zugerufen. Verwünschungsschreie gellten. Hinter ihm rotteten sich die Schreckensgestalten aus den Schenken zusammen. Panische Angst befiel den Gardisten. Er glaubte, noch immer die Schreie seiner sterbenden Gefährten zu hören.
Sie vermischten sich mit dem Keifen und Zetern des Pöbels hinter ihm, dazu die Schritte von immer mehr Füßen. Menschliche Ratten, wie der Teniente gesagt hatte. Sie vereinten sich zur gemeinsamen Angriffsrichtung. Ihr Haß und ihre Blutgier konzentrierten sich auf den Flüchtigen, der sich ihnen ausgeliefert hatte.
„Packt ihn!“ schrillte eine Frauenstimme.
„Dreht ihm den Hals um!“ geiferte eine andere, und gleich darauf steigerten sie sich in die wüstesten Tiraden. Vor allem die Hafenweiber waren es, die sich zu den übelsten Scheußlichkeiten verstiegen.
Der Gardist zerrte eine Pistole unter dem Gurt hervor und feuerte im Laufen nach hinten. Viel zu hoch sirrte die Kugel in die Dunkelheit. Er erntete nichts als höhnisches vielstimmiges Gelächter. Dafür aber nahm das hundertfache Geräusch von Schritten zu. Sie holten auf.
Schweißtropfen formten Bäche auf der Stirn des jungen Mannes, und er warf den Helm weg. Triumphierendes Gebrüll war die Antwort. In diesem Moment wußte er, daß er weder die Garnison noch die Residenz erreichen würde. Plötzlich erkannte er die Straße in Hafennähe, die er jetzt erreicht hatte.
Hier befand sich die Faktorei jenes aufrechten Mannes, jenes Deutschen namens Arne von Manteuffel. Manches Mal hatte er Übergriffen getrotzt, hatte sich erfolgreich letztlich auch gegen Vorstöße von Amts wegen zur Wehr gesetzt. Alonzo de Escobedo hatte in dieser Beziehung unrühmliche Beispiele geliefert, als er noch Gouverneur gewesen war.
Der Gardist sah die erleuchteten Fenster der Faktorei, die nur noch um Stein Wurfweite von ihm entfernt war. Diese Fenster strahlten Geborgenheit aus, Sicherheit, Unerschütterlichkeit. Sie schienen zum Greifen nah und waren doch unerreichbar fern. Die Schritte klangen näher, immer näher. Der Gardist streckte die Arme aus und schrie:
„Señor von Manteuffel! Señor von Manteuffel! Hilfe! Das Arsenal …“
Die hastenden Schritte und geifernden Stimmen schnappten wie eine Woge über ihn hinweg und begruben ihn unter sich. Dolche und Entermesser blitzten. Frauen kreischten in Blutgier. Die Stimme des Gardisten erstarb in einem Gurgeln. Er konnte nicht mehr sehen, daß oben in der Faktorei ein Fenster geöffnet wurde.
Der hochgewachsene blonde Deutsche blickte auf die Straße hinunter, in der die entfesselte Meute allem Anschein nach ein Opfer gefunden hatte. Aber noch konnte er sich das Geschehen nicht zusammenreimen, und er wußte, daß es Selbstmord bedeutet hätte, jetzt die sicheren Mauern des Kontorhauses zu verlassen.
Innerhalb von Stunden spitzte sich die Lage zu.
Die Lunte des Pulverfasses Havanna hatte nicht mehr aufgehört zu glimmen.
Bereits drei Tage nach dem Sturm auf das Arsenal stand fest, daß die kubanische Hauptstadt im Chaos zu versinken drohte. Die unbekannten Täter hatten das Arsenal restlos ausgeplündert.
Hunderte von Pistolen und Musketen waren ihnen in die Hände gefallen. Dazu fässerweise Vorräte an Schwarzpulver und entsprechende Mengen an Säcken voller fertig gegossener Kugeln. Außerdem Flints, Ersatzteile für die Schlösser der Waffen, Ersatzläufe, Werkzeuge, Gießzangen für Bleikugeln und Stangenblei.
Über den Verbleib der Beute herrschte noch immer Unklarheit. Wahrscheinlich, so vermuteten Capitán Marcelo und seine Offiziere, hatten die Galgenstricke Waffen, Munition und Zubehör überall im Hafengebiet von Havanna verteilt. Es war unmöglich, all die Ecken und Winkel, von Kellern bis zu Dachböden, von gelockerten Fußbodendielen bis zu herausnehmbaren Mauersteinen, zu durchsuchen. Dazu fehlte es der Miliz und der Stadtgarde an Einsatzkräften.
Die Patrouillen, die für Ordnung zu sorgen versuchten, bekamen indessen zu spüren, daß sie es mit einem Gegner zu tun hatten, der bis an die Zähne bewaffnet war und seine Waffen auch skrupellos einsetzte.
Nur aus dem Dunkel schlug der Gegner zu. Immer häufiger waren in diesen Nächten krachende Schüsse in den Gassen von Havanna zu hören. In den verriegelten Häusern erschauerten Männer, Frauen und Kinder, wenn sie die Todesschreie hörten.
Immer nur nachts traf es die Männer von Garde und Miliz, und immer wurden die tödlichen Kugeln heimtückisch aus dem Hinterhalt abgefeuert. Angst grassierte nicht nur bei den Bürgern. Auch die Milizsoldaten und Gardisten schämten sich nicht länger, ihre Furcht vor Heckenschützen einzugestehen.
Die finsteren Elemente hatten es nicht nötig, mit Blankwaffen auf die verhaßten Ordnungskräfte loszugehen. Beinahe gefahrlos konnten sie sich als Heckenschützen betätigen und die nächtlichen Patrouillen dort dezimieren, wo sie sich in den Lichtschein von Schenken oder anderen Häusern wagten und ein gutes Ziel abgaben.
Die vom neuen kommissarischen Gouverneur angeordnete Verstärkung der Patrouillen erwies sich als wirkungslos. Der revoltierende Pöbel reagierte mit neuen Taktiken. Immer häufiger stießen Patrouillen auf plündernde Horden, die hemmungslos über Lagerhäuser und Geschäfte herfielen, Türen und Fenster einschlugen. Sobald Patrouillen die Verfolgung aufnahmen, flohen die Täter in finstere Winkel, wo dann die Pistolen und Musketen der im Hinterhalt lauernden krachten.
Bevor Capitán Marcelo den Befehl ausgab, fliehende Plünderer nicht mehr zu verfolgen, waren bereits vier Nachtpatrouillen bis auf den letzten Mann niedergeschossen worden.
Es war am Abend des 29. Juni, als Don Luis Marcelo entschlossen die Rotweinflasche in den Schrank zurückstellte, ohne auch nur einen Schluck getrunken zu haben. Was in Havanna geschah, war ihm unter die Haut gegangen. Etwas von seiner alten Härte drang an die Oberfläche.
Die Offiziere, die er zur Lagebesprechung zusammentrommelte, glaubten, ihren Augen und Ohren nicht trauen zu können. Es war ein völlig veränderter Marcelo, den sie da plötzlich vor sich hatten. Einer, der auf einmal durchaus geeignet zu sein schien, den Gouverneursposten auszufüllen.
Es waren knappe und präzise Anweisungen, die Marcelo für die Nacht auf den 30. Juni erteilte.
„Jetzt schnappen wir uns die Strolche“, sagte er mit metallisch klingender Stimme. „Wir greifen uns mindestens ein Dutzend, besser zwanzig oder dreißig, und veranstalten einen Schauprozeß auf der Plaza. Kurz und schmerzlos. Aburteilung und Hinrichtung auf einen Schlag. Als Abschreckung werden die Delinquenten nach der Exekution zur Schau gestellt.“
So wurde die Zahl der Patrouillen in dieser Nacht verdreifacht, und dank der markigen Worte des kommissarischen Gouverneurs gingen die Männer mit neuer Zuversicht auf Streife.
Immerhin wußten sie auch, daß Marcelo selbst eine der Patrouillen führte. Und er hatte ihnen eingeschärft, das Licht der Häuser zu meiden und in keinem Fall das Risiko eines Hinterhalts einzugehen.
Um Mitternacht erreichten Capitán Marcelo und seine zehn Mann starke Patrouille eine der Gassen, die auf die Straße am Kai mündeten. Hier befanden sich die Handelskontore und Lagerhäuser, die Schiffsausrüster und Handwerker. Nachdem ihm das Gesindel während der vergangenen Stunden immer wieder entwischt war, sah Marcelo plötzlich die Gelegenheit vor Augen, auf die er gewartet hatte.
Читать дальше