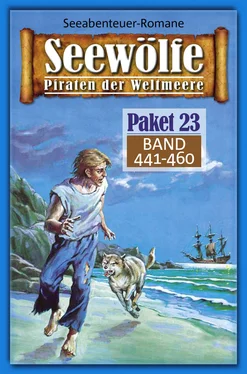Eine breite Grube wurde ausgehoben. Als sie fertig war, stand den Männern der Schweiß auf der Stirn.
„In diesen Höhen fällt sogar eine leichte Arbeit schwer“, sagte Stenmark. „Wie kann man da noch in Silberminen schuften! Das hält ja nicht mal ein Ochse aus.“
„Die armen Kerle müssen es aushalten“, sagte Hasard, „aber irgendwann brechen sie zusammen.“
Selbst dem hünenhaften Pater David stand der Schweiß auf der Stirn, als die Grube ausgehoben war. Er schnaufte, genau wie der Profos, der überrascht war, daß er bei einer leichten Arbeit schon kurzatmig wurde.
Einer nach dem anderen wurde in die Grube gelegt. Dann wurde Erde darüber geschüttet und die restliche Erde im Umkreis so verteilt, daß keine Spuren mehr zu erkennen waren.
„Jetzt noch zehn Baumstämme“, stöhnte der Profos, „das wird nochmal eine üble Plackerei.“
„Das geht aber nicht anders, Ed. Wenn die Stämme hier liegenbleiben, ist das genauso verräterisch, als hätten wir die Dons hier liegen lassen.“
„Stimmt, Sir. Also ran an die Arbeit. Wohin mit den Dingern?“
„Zur anderen Seite in die kleine Senke.“
Als sie die Baumstämme zu der kleinen Mulde schleppten, schüttelte der Profos den Kopf.
„Die sind für sechs Mann fast zu schwer. Stell dir vor, Dan, wir wären an die Dinger gefesselt und müßten sie von Arica bis nach Potosi schleppen. Da bricht man ja unterwegs schon zusammen.“
„Und dann kriegst du noch ständig die Peitsche ins Kreuz“, sagte Dan grimmig. „Das mußt du dir noch dazu vorstellen, dann weißt du, wie einem Indio zumute ist.“
„Und nach dieser Plackerei ist dein Leben so gut wie zu Ende, denn dann landest du in den Minen, ausgelaugt und halbtot. Und dort prügeln sie weiter auf dich ein.“
Diese Vorstellung darf man gar nicht zu Ende denken, überlegte Dan, sonst kann einem übel werden.
Wieder wurde eine breite, aber nicht sehr tiefe Grube ausgehoben.
Die beiden Padres standen vor dem Grab der Soldaten und sprachen ein kurzes Gebet.
„Möge der Herr im Himmel euch armen Sünder die Schandtaten verzeihen, die ihr hier auf Erden angerichtet habt“, sagte Pater Aloysius mit seiner tiefen Stimme.
„Amen“, fügte Pater David hinzu.
Als auch die Baumstämme unter der Erde verschwunden waren, war es bereits Nachmittag.
Sie überzeugten sich noch einmal gründlich davon, daß alle Spuren verwischt waren. Es gab nichts Auffälliges mehr zu sehen.
„Dann ziehen wir weiter“, sagte Hasard. „Es besteht jetzt natürlich die Möglichkeit, daß wir wieder auf Spanier stoßen! Wir müssen also immer gut aufpassen.“
Carberry vergewisserte sich inzwischen, ob sein „Diegolein“ auch gut bepackt war, damit die Lasten nicht an seinem Kreuz scheuerten. Er fand alles in Ordnung – bis auf das dämliche Grinsen, das der Halbesel wieder drauf hatte. Er grinste Carberry regelrecht an und nickte dazu ständig. Aber er hatte sich in den letzten Tagen lammfromm verhalten und war auch nicht mehr so tückisch.
„So, jetzt geht’s weiter, du Furztrompeter“, sagte Carberry. „Benimm dich auch in Zukunft anständig.“
Diego nickte immer noch, dann erfolgte wieder das sattsam bekannte Donnern, das die Männer zusammenzucken ließ. Ein recht merkwürdiges Vieh war das schon, das konnte niemand abstreiten.
Es ging weiter über die „Straße“ nach Potosi, ein kaum erkennbarer Pfad, der im harten Untergrund kaum sichtbar war.
Einmal sahen sie an diesem Tag drei junge Vicuñas, die in einer Mulde standen und ästen. Die Tiere waren völlig überrascht worden, aber jetzt jagten sie los, die Hälse vorgestreckt, die Ohren ganz zurückgelegt. Feingliedrige, graziöse Tiere waren das, die aus der Ferne wie kleine Kamele aussahen. Sie rasten meilenweit in einem höllischen Tempo und verschwanden schließlich hinter einer Senke. Als sie wieder auftauchten, waren sie mindestens drei bis vier Meilen entfernt.
„So müßte man rennen können“, sagte Stenmark, „dann wären wir gleich in Potosi. Wie lange wird das noch dauern?“ fragte er dann Pater Aloysius.
„Fünf bis sechs Tage ganz sicher noch.“
„Und über die Berge müssen wir auch noch einmal?“
„Ja, über die Cordillera de los Frailes. Wenn wir in dem Tempo weitermarschieren, dürften wir sie übermorgen erreichen.“
Stenmark legte die Stirn in Falten und dachte nach.
„Übermorgen – ist das nicht ein besonderer Tag?“
„Weihnachten“, sagte der Padre andächtig. „Der Tag der Geburt des Gottessohnes, ein ganz besonderer Tag.“
„Na, Wein zum Feiern haben wir ja“, sagte Sten.
„Und ein Schlückchen vom Öl des heiligen Vaters“, setzte Carberry hinzu. „Ich hoffe, du wirst da etwas großzügiger sein, Bruder. In letzter Zeit hast du arg damit geknausert.“
„Es ist auch nicht mehr viel da, deshalb.“
„Und übermorgen?“
„Das ist etwas anderes.“
„Hoffentlich ist bald übermorgen“, murmelte Ed. „Ich kann es kaum noch erwarten.“
„Wir werden heute eine Stunde länger marschieren“, sagte Hasard. „Dann haben wir die Puna auch bald hinter uns. Oder hat einer etwas dagegen?“
Keiner hatte Einwände. Sie alle brannten darauf, bald in Potosi zu sein.
An diesem Tag marschierten sie bis in die Dunkelheit hinein. Über der Puna stand als fahler Ballon der Mond. Er schien in trüben Dunst eingehüllt zu sein.
„Wird wieder lausig kalt werden, heute nacht“, sagte Aloysius. „Immer wenn der Mond diese sonderbare Färbung annimmt, wird es in der Nacht bitterkalt.“
„Man spürt es jetzt schon in allen Knochen“, meinte Dan. „Wir werden uns eine besonders tiefe Senke suchen.“
Eine Stunde später fanden sie einen geeigneten Platz. Der Wind strich scharf und kalt über die Einöde.
„Hier bleiben wir“, sagte Hasard, „hier sind auch die Mulis gut vor dem Wind geschützt.“
Wieder begann das lang eingeübte Ritual des Abladens. Gefressen hatten die Mulis schon unterwegs, und an einem winzigen Rinnsal hatten sie ihren Durst gestillt.
Jetzt wurden ihnen wieder wärmende Decken über die Körper gelegt.
Die anderen schlugen inzwischen die beiden Zelte auf und sicherten sie gegen den immer stärker wehenden Wind. Er war eisigkalt und brachte Frost mit.
Als alles fertig war, hatten sie trotz der Handschuhe klamme Finger, und die Kälte fraß sich bis in die Knochen.
Die Maultiere standen dicht zusammengedrängt und schützten sich gegenseitig mit ihren Körpern. Carberry legte ihnen noch weitere Decken auf, damit sie nicht froren.
Über die Puna jaulte der Wind in grellen disharmonischen Tönen. In dieser Mulde war es noch einigermaßen geschützt, aber trotzdem verspürten sie die beißende Kälte.
Den Tag über marschierten sie. Sie hatten sich an das Tempo und die tagelangen Fußmärsche gut gewöhnt. Auch von der Höhenkrankheit war nichts mehr zu spüren. Niemand hatte Kopfschmerzen oder litt an Übelkeit und Schwindel.
Der Bergzug, den sie zu überqueren hatten, die Cordillera de los Frailes, war klar und deutlich zu erkennen. Er lag fast greifbar nahe vor ihnen, und doch war er noch einen guten Tagesmarsch entfernt. Sie würden ihn erst am Heiligen Abend erreichen, wie Pater Aloysius schon gesagt hatte.
Diesmal marschierten sie wieder länger in die Nacht hinein, und kampierten erst dann, als der Mond schon längst am Himmel stand.
„Die letzte Etappe liegt vor uns“, sagte Hasard am 24. Dezember. „In ein paar Stunden beginnt der Aufstieg, und die Puna liegt achteraus. Wie sieht es da oben mit Höhlen aus, Padre?“
„Wenn wir fleißig aufsteigen, haben wir bis zum Abend eine Höhle erreicht. Wir müssen aus einer Schlucht aufsteigen und befinden uns dann unterhalb eines Felsenkammes, wo es eine gute Höhle gibt.“
Читать дальше