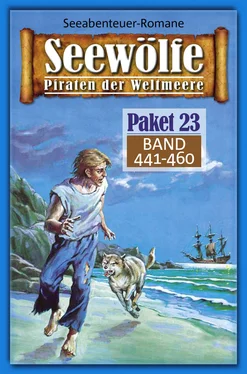„Old O’Flynn kann fast alles“, erklärte Ed, und dann verstieg er sich gleich zu einer weiteren Behauptung, die bei den anderen Kopf schütteln auslöste.
„Irgend etwas stimmte mit dem Geier jedenfalls nicht. So benimmt sich kein Kondor.“
„Woher weißt du denn, wie sich ein Kondor benimmt?“
„Vielleicht war’s ein spanischer Spion, den sie von Potosi geschickt haben, um hier die Gegend zu überwachen. Sie können ihn ja dressiert haben, so wie man das mit Albatrossen macht – oder wir mit den Brieftauben auf der Schlangen-Insel.“
Der Seewolf griff sich verzweifelt an den Kopf.
„Laß das bloß keinen hören. Ed. Ein Kondor als spanischer Spion! Und der fliegt jetzt zurück und verklart den Dons, daß ein Dutzend Engländer unterwegs ist, um Potosi anzugreifen.“
„Warum nicht“, sagte Ed ungerührt. „Das ist eben meine Theorie.“
„Und du glaubst, er spricht Spanisch mit den Dons?“ fragte Dan höhnisch.
Die Antwort haute ihn fast um.
„Ich hab noch keinen Kondor quatschen hören. Aber sie können ihm ja beigebracht haben, daß er beispielsweise so und so oft mit den Flügeln schlägt. Ein Stummer quasselt ja auch nicht, sondern drückt sich durch Gesten aus.“
Hasard lachte verhalten. Mitunter entwickelte der Profos Theorien, die himmelschreiend waren.
„Erst war’s der alte O’Flynn“, sagte er lachend, „und als das nicht zog, wurde ein spanischer Spion daraus, der sich durch Flügelschlagen verständigt.“
„Lacht nur“, maulte Ed beleidigt. „Ein normaler Kondor war das jedenfalls nicht, sonst hätte er nicht so geglotzt.“
Darin mußten sie ihm allerdings recht geben. Das Verhalten des Vogels war recht ungewöhnlich gewesen.
„Vielleicht war’s Sir John“, sagte Matt grinsend, „der Kreischgeier hat sich in einen Kondor verwandelt und wollte mal sehen, wie’s dem lieben Herrn und Meister so geht. Deswegen hat er dich auch besonders genau gemustert.“
„Meinst du?“ fragte Ed zweifelnd.
„Davon bin ich überzeugt.“
Pater Aloysius amüsierte sich köstlich. Die Kerle führten so erbauliche Dialoge, daß keine Langeweile aufkam. Er fühlte sich in ihrer Gesellschaft ausgesprochen wohl.
In dieser Nacht kampierten sie wieder in einer der zahlreichen Mulden, die etwas vor dem beißenden Wind geschützt waren. Dann begann der dritte Tag ihres Marsches durch die Puna.
Hasard hatte grob gerechnet, daß sie pro Tag etwa dreißig Meilen zurücklegten. Es gab keine Hindernisse mehr und so konnten sie stramm und zügig marschieren.
Am Vormittag wurde Dan O’Flynn auf ein paar winzige Punkte aufmerksam, die die anderen noch nicht bemerkt hatten. Sie waren auch noch sehr klein und kaum zu bemerken.
„Da bewegt sich etwas“, sagte Dan.
Er ging zu dem Maultier hinüber und nahm ein Spektiv aus der Satteltasche. Langsam zog er es auseinander und blickte gespannt hindurch.
„Eine langgezogene Kolonne“, murmelte er. „Sie bewegt sich in östlicher Richtung.“
„Soldaten?“ fragte Hasard.
„Ja, Soldaten, Maultiere und gebeugte Gestalten. Offenbar Gefangene – Indios.“
„Sklaven für Potosi“, sagte Hasard hart. „Das ist eine logische Schlußfolgerung. Die Trupps aus Arica sind mal wieder am Werk gewesen, um menschliches Arbeitsvieh zu beschaffen. Da steigt mir die Galle hoch. Das sind jene Trupps, die auch die Padres von Tacna vereinnahmen wollten.“
„Wenn ihr nicht eingegriffen hättet, wären wir jetzt sicher auch schon in Potosi“, sagte Aloysius grimmig.
Hasard deutete auf die kaum sichtbaren Punkte und wandte sich fragend an den Padre.
„Ist das die Route Arica-Potosi?“
„Ja, das ist sie“, bestätigte Aloysius. „Sie verläuft vom Westen her.“
„Was tun wir, Sir?“ fragte Ed kampflustig. „Den Dons eins auf die Ohren hauen?“
„Zuerst gehen wir in jener Mulde dort in Deckung, damit wir nicht gesehen werden. Dann beratschlagen wir.“
Er warf auch noch einen Blick durchs Spektiv und nickte grimmig.
„Ja, kein Zweifel, es sind Gefangene.“
Die Mulde bot guten Sichtschutz. In aller Eile verbargen sie sich mit den Maultieren darin.
„Ich bin dafür, daß wir die Gefangenen befreien“, sagte Hasard. „Ist jemand anderer Meinung?“
„Ich ganz bestimmt nicht“, versicherte Ed. „Diesen Menschenschindern gehört ordentlich was aufs Maul.“
Die beiden streitbaren Padres waren ebenfalls dafür, und auch die anderen stimmten sofort zu.
„Gut, dann pflocken wir jetzt die Maultiere an und überprüfen unsere Waffen“, sagte der Seewolf. „Einer muß bei den Tieren zurückbleiben. Wer übernimmt das?“
Keiner meldete sich. Der Profos blickte in eine andere Richtung, als könne er mit der Frage niemals gemeint sein.
„Hm, dann lassen wir das Los entscheiden.“
Das Los fiel schließlich auf Gary Andrews, der in der Mulde bei den Tieren zurückbleiben mußte. Die Mulis wurden angepflockt, dann überprüften sie ihre Pistolen und steckten auch die Entermesser ein.
„Wir bleiben immer in Deckung der Mulden“, sagte Hasard. „Also in südöstlicher Richtung. Dort werden wir die Kolonne abfangen.“
Gary Andrews blickte ihnen nach, als sie von Deckung zu Deckung eilten. Er wäre gern mit dabei gewesen, aber das Los hatte nun mal anders entschieden.
Kurz nach Mittag näherte sich der traurige Zug.
Hasard hatte mit seinen Männern zwei Hügel besetzt, zwischen denen der Trampelpfad nach Potosi sichtbar war.
Was sich jetzt da näherte, war ein Zug des Elends, der Angst und der Verzweiflung. Er biß sich auf die Lippen, als er das sah.
Zwölf Soldaten unter einem Teniente begleiteten den traurigen Zug. Sie waren mit Peitschen ausgerüstet, die sie wahllos und äußerst brutal einsetzten. Schon jetzt war das Schreien und Stöhnen Verzweifelter zu hören, die sich unter den unbarmherzigen Schlägen ihrer Peiniger angstvoll duckten.
Hasard zählte zu seinem Entsetzen genau sechzig Indios. Je sechs waren an einen Baumstamm gefesselt, den sie zwischen sich mitschleppen mußten.
Er knirschte mit den Zähnen, als er das sah. Neben ihm schob Carberry sein Rammkinn vor.
„Schweinehunde“, flüsterte er. „Sieh dir nur diese armen Teufel an, Sir. Sie schleppen völlig nutzlos zehn Baumstämme von Arica nach Potosi und werden dafür auch noch geprügelt.“
„Ja, eine raffinierte und höllische Methode der Dons. Damit sind sie sicher, daß keiner der Indios entwischen kann.“
Sie lagen zu fünft auf dem Hügel. Fünf andere Männer befanden sich auf dem gegenüberliegenden Hügel. Die Kolonne mußte genau zwischen den beiden Hügeln hindurch.
Hasard sah verzweifelte, verängstigte Gesichter und dachte an die stolze Familie, deren Obhut sie Fred Finley anvertraut hatten. Es hätten auch die Männer vom Hof dabei sein können.
Er dachte an die Kunstwerke, die die Vorfahren dieser Indios geschaffen hatten, an die alte Kultur, die von Pizarro unbarmherzig und für immer ausgelöscht worden war. Und er dachte an die Frauen und Kinder, die hilflos zurückblieben und zusehen mußten, wie sie mit dem Leben fertig wurden.
Und das alles geschah im Namen Seiner Allerkatholischsten Majestät, damit die Schatullen gefüllt wurden und die Dons weiter Kriege führen konnten, um noch mehr Menschen zu unterjochen und auszubeuten.
Verdammte Bluthunde, dachte er angewidert. Diese gefangenen Indios konnten mit ihrem Leben abschließen. Sie würden auf immer in den Silberminen verschwinden, gepeinigt, geschlagen und entwürdigt.
Der Teniente, der den traurigen Zug führte, schien ein ganz besonderes Früchtchen zu sein, oder er hatte einfach seinen Spaß daran, die wehrlosen Indios zu schlagen.
Die Gefangenen schleppten an ihren schweren Baumstämmen und konnten sich unter der schweren Last nicht schneller bewegen, aber dem Kerl ging das offenbar alles zu langsam. Er ließ die Peitsche durch die Finger gleiten und holte grinsend aus.
Читать дальше