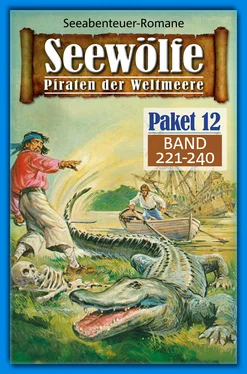Einen genauen Überblick über die Geschehnisse zu beiden Seiten der Insel hatte in diesem Moment praktisch nur ein Mann.
Dieser Mann hieß Regis La Menthe.
Weder der Seewolf noch sonst jemand von der „Isabella“ war diesem La Menthe je zuvor begegnet, und auch umgekehrt hatte La Menthe nicht die geringste Ahnung, wer die Männer sein mochten, die vom Strand der Westbucht her ins Innere der Insel vordrangen.
Dennoch sollte es zwischen ihnen zu einer Begegnung kommen, zu einem sehr unerfreulichen Treffen allerdings.
Regis La Menthe saß hoch oben auf einem kleinen Plateau in den Bergen, an deren Hängen Sam Roskill und Luke Morgan sich ein Kastell hätten vorstellen können. Oder, besser gesagt, er thronte auf einem hölzernen Gestühl, das einer seiner schwarzen Diener ihm hatte nachtragen müssen, als sie zusammen hier heraufgestiegen waren.
Einer der Neger hielt jetzt einen aus Schilfmatten geflochtenen Sonnenschirm über La Menthes kahles Haupt, während der andere seinem Gebieter mit einem großen Federbusch Kühlung zufächelte.
Der vierte Mann in der seltsamen Versammlung war wiederum ein Weißer, und zwar ein gedrungener, bullig wirkender Mann mit groben Zügen und einem verkniffenen Gesichtsausdruck. Er stand nicht weit abseits und hielt eine geladene Muskete in den Fäusten, mit der er sofort auf die Sklaven schießen würde, falls diese auch nur ansatzweise etwas wie einen Fluchtversuch oder eine Rebellion wagten. Zusätzlich hatte er zwei Pistolen und ein Entermesser in seinem breiten Leibgurt stecken.
La Menthe, der aus der französischen Hafenstadt Dieppe stammte, beobachtete interessiert durch sein mit Messing und Perlmutt besetztes und mit Gravuren verziertes Spektiv, was draußen auf See und am Strand der Westbucht geschah.
Als an Bord der „Novara“ die Schreie ertönten und mit dem Nordost-Passat bis zu den Inselbergen getragen wurden, hob auch der vierte Mann wie witternd seinen wuchtigen Kopf.
„Ja, Duplessis“, sagte La Menthe. „Es sind Menschen, die da um Hilfe rufen und sich womöglich gegenseitig über den Haufen rennen, denn sie sind in Gefahr. Sie treiben geradewegs auf den Strudel zu, der sich wieder einmal vor dem großen Riff gebildet hat. Ich sage dir, es sind Narren. Aber sie sind auch Störenfriede, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, und daher ist es gut, wenn sie wie die Ratten ertrinken.“
„Gut“, wiederholte Duplessis und nickte dazu. „Ein großes Schiff?“
„Zwei Schiffe, mein Freund“, erwiderte La Menthe. Er lächelte ein wenig. „Zwei Galeonen, jede mit drei Masten, und beide fast gleich groß – und doch scheint das eine Schiff mit dem anderen nichts zu tun zu haben. Das zweite, Duplessis, liegt bereits in unserer schönen Westbucht vor Anker. Es hat acht Gestalten ausgespuckt, die jetzt im Gebüsch herumkriechen und irgend etwas zu suchen scheinen.“
„Wasser“, sagte Duplessis. „Und Nahrung. Was sonst? Der Teufel soll sie holen.“
„Er wird sie holen, wenn sie zu neugierig sind“, sagte La Menthe. Er war ein sehniger, kräftiger Mann, aus dessen harten Zügen die Mentalität eines unerbittlichen Herrschers sprach. „Wie gut, daß ich auf meinen gewohnten Spaziergang nicht verzichtet habe. Es tut sich heute viel. Viel zuviel für meine Begriffe. Es wird noch Ärger geben.“
Duplessis blickte aus schmalen Augen mal nach Osten, mal nach Westen, aber ohne die Zuhilfenahme des Spektivs konnte er die fremden Schiffe nicht erkennen.
La Menthe reichte ihm in einer gönnerhaften Geste das Rohr. „Hier, wirf selbst mal einen Blick hindurch. Gib mir solange die Muskete.“ Er lehnte sich in seinem Gestühl zurück und streckte die Beine weit von sich, nahm die Muskete aus der Hand seines Landsmannes entgegen und verfolgte fast amüsiert, wie dieser angestrengt hindurchspähte.
„Der Henker mag wissen, warum dieses eine Schiff auf den Sog zuläuft“, brummte Duplessis. „Ist der Kapitän des Wahnsinns, daß er die Gefahr nicht erkennt?“
„Das ist auch mir ein Rätsel“, erklärte La Menthe. „Aber ich habe das untrügliche Gefühl, wir erfahren noch, was der Grund dafür ist, daß er geradewegs in sein Verderben segelt.“
„Und was tun wir?“ wollte Duplessis wissen.
„Wir warten ganz einfach ab.“
„Sie werden alle ertrinken.“
„Und wir rühren keinen Finger für sie“, sagte Regis La Menthe.
„Und die anderen Kerle?“
„Das Schicksal spielt sie uns in die Hände“, antwortete La Menthe. „Ich denke, wir könnten ihre Galeone gut gebrauchen. Es scheint ein prächtiges Schiff zu sein, groß, robust und gut armiert.“
Panik war an Bord der „Novara“ ausgebrochen, denn alle, vom Kapitän bis zum letzten Decksmann, wußten jetzt, was die Stunde geschlagen hatte. Steuerlos trieb die Galeone vor dem Wind, dazu verdammt, in dem tückischen Strudel zu enden.
„Geit auf die Segel!“ schrie Fosco Sampiero vom Achterdeck aus. „Weg mit dem Zeug, verdammt noch mal!“
Die Männer auf dem Hauptdeck hasteten eher ziellos auf und ab und gerieten sich gegenseitig ins Gehege. Roi Lodovisi tat so, als habe er selbst den Kopf verloren. Er brüllte unsinnige Befehle und schlug und trat nach den Männern, die sich in seiner unmittelbaren Nähe befanden.
So vergrößerte er das Durcheinander noch, statt es einzudämmen und für Disziplin zu sorgen – wie es seine Pflicht gewesen wäre.
Sampiero stieg selbst auf die Kuhl hinunter. Er wollte hart durchgreifen und notfalls mit der neunschwänzigen Katze für Ordnung sorgen. Doch ein gellender Schrei, der jetzt aus dem Achterkastell drang und sich in die Rufe der entsetzten Männer mischte, hielt ihn zurück.
Er hatte die Stimme erkannt, sie gehörte seiner Frau Bianca!
Fosco Sampiero fuhr auf dem Absatz herum, riß die Tür zum Achterkastell auf und stürmte in den Gang. Er prallte fast mit Tosca Venturi und Ivana Gori zusammen, die ihre Kammern verlassen hatten und verstört um sich blickten. Der Lärm an Deck hatte sie aus ihrer Nachmittagsruhe gerissen, aus dem Schlummer, mit dem sie die Zeit totzuschlagen suchten, da sie die meiste Zeit des Tages auf Sampieros Anordnung hin unter Deck zu verbringen hatten.
Bianca Sampiero stand am Ende des Ganges vor der offenen Kapitänskammer und schrie erneut auf. Ihr Mann schob sich an den anderen beiden Frauen vorbei und lief zu ihr.
Verdammt, dachte er, du hast dich breitschlagen lassen, die Frauen mitzunehmen, nur für diese eine Reise, gewiß, aber es war doch ein Fehler, und der Teufel hat dich geritten, als du ihren Bitten nachgegeben hast.
„Mein Gott, Bianca!“ rief er. „Was ist? So beruhige dich doch. Wir …“
Er unterbrach sich, denn jetzt sah er endlich die Gestalt, die auf der rechten Seite des Ganges kauerte und sich an der Wand aufzurichten versuchte.
„Medola!“ schrie der Kapitän. „Gerechter Himmel! Sind Sie verletzt?“
„Nicht der Rede – wert, Signor Capitano“, sagte der Bootsmann mühsam. „Er hat mich gestochen, der Hund – aber – aber ich weiß, wer’s war. Zorzo – Mario Zorzo – der Satansbraten. Möge der Herr mir verzeihen, daß ich – in die Falle gegangen bin. Das Ruder – es ist zersägt, Capitano.“
„Wo sind Cavenago und Teson?“
„Noch – unten.“
„Ihr Frauen kümmert euch um ihn!“ rief Sampiero. Dann hatte er auch schon seine Radschloßpistole gezückt und lief zum nächten Niedergang.
„Aufpassen“, flüsterte Vittorio Medola noch. „Das Wasser – im Frachtraum ist ein Leck. Oder – mehrere Lecks. Ich …“
„Was sagt er?“ fragte Tosca Venturi, die nähergetreten war und angestrengt versuchte, etwas von den Zusammenhängen zu begreifen.
„Ich verstehe ihn nicht mehr“, entgegnete die Frau des Kapitäns. Sie beugte sich über den Bootsmann, um ihn anzusprechen, sah aber, daß dieser inzwischen ohnmächtig geworden war.
Читать дальше