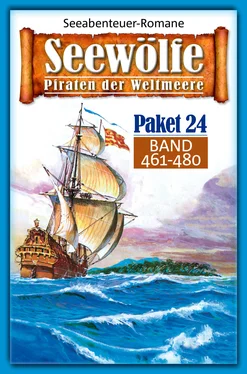Danach wollten sie aufbrechen. Coanabo holte das große Häuptlingskanu, in dem seine neuen Freunde Platz nehmen sollten. Er wollte sie persönlich zur Bight begleiten.
Doch noch einmal gab es einen Zwischenfall, der alle in Angst und Schrecken versetzte.
Etwas abseits vom Strand hockte ein Bürschchen am Wasser in der Nähe der Mangroven und angelte. Der Kleine hatte schon zwei Fische an Land gezogen und ging jetzt voller Eifer bis an die Hüften ins Wasser.
Nils Larsen schaute gerade in die Richtung und sah etwas durch das Wasser treiben. Es sah wie ein Ast aus, aber da hier nur eine sehr schwache Strömung ging, konnte der Ast verständlicherweise keine „Bugwelle“ vor sich herschieben. Das tat er aber.
Nils sah jetzt zwei Augen aus dem Wasser ragen und eine Schnauze, die sich unmerklich höher hob.
„Ein Kaiman!“ brüllte er entsetzt. „Er schwimmt auf den Jungen zu.“
Er hatte spanisch gesprochen, damit auch Coanabo ihn verstand.
Der Häuptling fuhr herum und starrte zu der Stelle, wo der ahnungslose Junge angelte. Der war so in die Angelei vertieft, daß er die Gefahr gar nicht bemerkte.
Coanabo rief etwas mit lauter Stimme. Der Junge zuckte zusammen, warf die Angel weg und wollte türmen.
In diesem Augenblick schlug die große Echse peitschend mit dem Schwanz durchs Wasser. Ein kochender Wirbel entstand. Der Druck riß den Jungen um, der jetzt zu brüllen begann.
Nils Larsen raste in langen Sätzen zu dem Kanu. Zum Glück hatten die Indianer nicht nur Kochtöpfe gemaust, sondern auch Musketen und Pistolen.
Im selben Augenblick reagierte auch der Profos. Er sah einen dicken Knüppel unter einem Baum liegen, hob ihn hoch und stürmte unter lautem Gebrüll zum Wasser. Auch Plymmie fegte los, als Philip ihr etwas zurief.
Inzwischen hatte Nils die Muskete in der Hand und rannte weiter. Das Bürschchen im Wasser brüllte in Todesangst, als die Panzerechse wild zuschnappte. Offenbar ist es dieselbe, die sich gestern noch hier gesonnt hat, dachte der Profos, und der man weiter keine Beachtung geschenkt hatte. Jetzt versprach sich das Vieh fette Beute.
Auch ein paar Indianer waren inzwischen losgerannt, allen voran der Häuptling.
Carberry erreichte die Stelle als erster. Mit ein paar Sätzen lief er ins flache Wasser. Das Riesenvieh riß gerade wieder den fürchterlichen Rachen auf. Der Junge lag auf der Seite im Wasser und war vor Angst wie gelähmt.
Der Profos zögerte keine Sekunden. Als das klaffende Maul sich öffnete, rammte er voller Wut und mit aller Kraft den schenkelstarken Ast in den Rachen.
Die Echse schnappte zu. Krachen und Splittern. Der Knüppel zerbrach wie ein dünnes Hölzchen. Der Kaiman begann zu toben und wild mit dem Schwanz zu schlagen.
Da war auch Nils Larsen heran. Er hob die Muskete an die Schulter, zielte kurz und drückte ab, als er den Schädel vor sich sah.
Der Schuß brach sich überlaut im Dschungel, wo plötzlich jedes Geräusch schlagartig erstarb.
„Treffer!“ brüllte Carberry.
Der Riesenkörper des Kaimans begann zu zucken und zu toben und schob sich höher auf den Morast hinauf.
Das seichte Wasser färbte sich rot und schaumig. Noch ein paar zuckende Bewegungen, und die Echse lag still da. Die Kugel hatte ihr den Schädel zertrümmert.
Schnaufend holte der Profos das stocksteife Bürschchen aus dem Wasser, noch ehe die anderen heran waren. Am Strand zitterte der Kleine so stark, daß sie ihn festhalten mußten.
Mit dieser Tat hatten sie sich weitere Dankbarkeit erworben und waren wieder einmal die Helden des Tages.
Eine verstörte Mutter kam angerannt und warf sich vor dem Profos schluchzend zu Boden. Ein paar andere Männer sahen Nils und den Profos bewundernd an.
„Ohne euch würde der Junge nicht mehr leben“, sagte Coanabo. „Es passiert hier nur selten, daß einer von einem Kaiman angegriffen wird, aber es passiert eben doch hin und wieder. Das letztemal war es eine Frau, die spurlos verschwand.“
„Jetzt ist ja wieder alles gut“, sagte Carberry. „Das Biest ist erledigt.“
Eine halbe Stunde später brachen sie auf. Es war jetzt Vormittag, und vom Himmel knallte erbarmungslos heiß die Sonne. Etwas später, als sie im großen Kanu des Häuptlings saßen, ging mit der üblichen Heftigkeit ein kurzer Wolkenbruch nieder.
Die Indianer hatten alle gemopsten Sachen wieder in das Kanu gepackt. Es fehlte nichts.
Old O’Flynn packte die Schiffshauer und Messer auf die andere Seite und trennte sie von den übrigen Sachen. Auch einen großen Kochtopf packte er noch dazu.
„Die Sachen gehören euch“, erklärte er dem Häuptling. „Ihr könnt sie behalten, und wenn wir uns wiedersehen, werden wir noch mehr und andere Dinge mitbringen.“
Coanabo bedankte sich überschwenglich. Ja, eiserne Werkzeuge konnten sie gut gebrauchen, das Geschenk freute ihn ganz besonders, und das sagte er den Mannen auch.
„Ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder“, sagte er. „Ich möchte auch eure anderen Brüder und euren Kapitän kennenlernen. Vielleicht könnt ihr uns auch genau erklären, wo ihr euch niedergelassen habt, für den Fall, daß wir den großen Medizinmann einmal ganz dringend brauchen.“
„Wir haben Karten an Bord“, erwiderte der Kutscher. „Mit ihrer Hilfe werden wir dir die Lage genau erklären. Aber wie wollt ihr zu unserer Insel gelangen?“
„Für den Besuch der umliegenden Inseln haben wir kleine Auslegerboote mit Mattensegeln“, erklärte Coanabo. „Aber wir segeln die Strecken nur nachts, um fremden Schiffen ausweichen zu können. Wir wollen ja nicht zur See fahren.“
Die Abfahrt begann. Auf den Plattformen der Hütten standen winkende Gestalten, die ihnen fröhliche Worte nachriefen. Der kleine Junge winkte und schrie so lange, bis sie ihn aus den Augen verloren. Hasard und Philip hatten ihn vorhin noch auf Plymmie reiten lassen, zum großen Gaudium der anderen Zuschauer.
Dann war das Pfahldorf ihren Blicken entschwunden, und es ging in den Creek hinein, wo die Arawaks ihnen unvermutet aufgelauert hatten.
„Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht“, sagte Sven Nyberg. „Gestern um die Zeit haben wir uns ganz schön abgezappelt.“
Coanabo lachte leise, als er das hörte. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie ratlos sie gewesen sein mußten.
„Ja, es ist sehr schwierig, sich hier zurechtzufinden. Selbst wenn man die Strecke schon ein paarmal gefahren ist, kennt man sich noch nicht genau aus.“
Zur Verblüffung der Männer ging es nach knapp hundert Yards creekabwärts auf der linken Seite in eine schmale und enge Einfahrt hinein. Sie war so gut getarnt, daß man sie übersah.
Es war ein kleiner natürlicher Kanal, der sich mitten durch ein Mangrovendickicht schlängelte. Sie befanden sich kaum darin, als die Einfahrt auch schon wieder unsichtbar wurde.
„Den hätten wir selbst bei intensiver Suche kaum gefunden“, sagte Martin, „so vorzüglich getarnt ist er.“
Die Indianer paddelten zielsicher und sehr geschickt durch das Mangrovengestrüpp. Es sah so aus, als sei die Fahrt jeden Augenblick zu Ende, aber das war nicht der Fall.
Das winzige Bächlein mündete in einen größeren Creek.
„Wir paddeln jetzt in südlicher Richtung“, sagte Coanabo, „ihr aber seid fast in die entgegengesetzte Richtung gepaddelt. Aber dort versanden viele Creeks oder münden in kleinere Seen.“
„Stimmt genau“, sagte der Kutscher beeindruckt. „Hier findet sich kein Fremder mehr zurecht. Falls die Spanier das mal irgendwann versucht haben, dann sind sie steckengeblieben oder haben sich hoffnungslos in dem Labyrinth verirrt.“
Der Kutscher nahm an, daß es auf diesem breiteren Creek längere Zeit geradeaus ging, doch auch darin sah er sich getäuscht. Schon bald darauf verließen die Kanus – weitere neun folgten dem großen Häuptlingskanu – den Creek und bogen nach links ab. Auch diesen winzigen Kanal hätten die Arwenacks glatt übersehen, denn er war ebenfalls auf ganz natürliche Weise getarnt.
Читать дальше