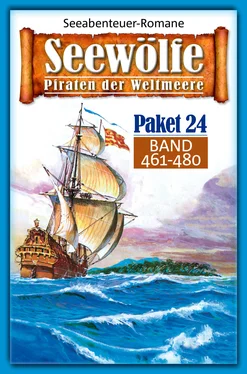Er dachte im Bruchteil einer Sekunde an seine Zeit bei Doc Freemont in England zurück. Sehr lange war er nicht mehr mit einem eitrigen Abszeß im Rachenraum konfrontiert worden. Etliche Jahre lag das schon zurück. Aber er wußte noch genau, was in diesem Fall getan werden mußte. Aufstechen, den Eiter abfließen lassen, sonst erstickte das arme Kerlchen bald.
„Was ist los?“ fragte Old O’Flynn neugierig. „Was hat er?“
„Einen eitrigen Abszeß im Hals“, erklärte der Kutscher gelassen. „Da hilft alles nichts – ich muß schneiden.“
Old O’Flynn wurde sichtlich blaß und rang nach Fassung. Er spürte, daß ihm eine Gänsehaut über den Rücken kroch.
„Himmel, wenn das nur gutgeht“, murmelte er beklommen. „Wenn nicht, dann läßt uns der Kerl die Köpfe absäbeln.“
„Damit rechne ich auch. Es muß eben gutgehen. Du kannst mir ja den Daumen halten.“
„Sicher, sicher“, versprach Old O’Flynn, „alles, was du willst. Bau bloß keinen Mist, Kutscher.“
„Verschlimmert wird die Sache dadurch, daß der Kleine ein Enkelchen vom Häuptling ist“, sagte der Kutscher lässig. „Das zählt natürlich gleich zehnfach.“
Old O’Flynn begann noch mehr zu bibbern. Teufel, Teufel auch, dachte er, da hatten sie sich ja was Feines eingebrockt.
Laß den alten Rutschensauser nur ein bißchen zittern, überlegte der Kutscher. Schließlich hatten sie das alles seiner Dösigkeit zu verdanken.
Der Kutscher drehte sich zu Coanabo um, zeigte in den Hals des Jungen und erklärte ihm kühl und lässig, was ihm fehlte.
„Ist das sehr schlimm?“ fragte der Häuptling.
„Sehr schlimm“, bestätigte der Kutscher. „Und dazu brauche ich die Instrumente, mit denen die Kerle herumgespielt haben. Du siehst also, daß so etwas über Leben und Tod entscheiden kann. Daher war meine Wut auch berechtigt.“
„Kannst du ihn heilen?“
„Ich werde es versuchen. Natürlich ist das sehr kompliziert. Ich frage mich nur, warum euer Medizinmann das nicht tut. Oder habt ihr etwa keinen?“
Der Kutscher registrierte kühl, daß Coanabo etwas verlegen wurde.
„Er hat es versucht, aber es ist nicht besser geworden. Außerdem ist der Medizinmann zur Zeit selbst sehr krank.“
„Aha“, sagte der Kutscher höflich. Der Kerl wollte nur nicht zugeben, daß er nicht helfen konnte, und so spielte er vorsichtshalber den kranken Mann.
„Da ist noch etwas“, meinte der Kutscher so nebenbei. „Eine Hilfe ist die andere wert, wie man so schön sagt. Da es ein äußerst komplizierter Fall ist, verlange ich, daß meine Kameraden befreit werden, wenn es mir gelingt, den Kleinen zu heilen.“
„Deine Kameraden werden befreit werden“, versprach Coanabo feierlich und nickend.
„Die geklauten Sachen müssen aber auch zurückgegeben werden. Das gehört sich so.“
„Ich verspreche auch das.“ Diesmal klang die Stimme nicht mehr so feierlich, eher etwas säuerlich.
„Und noch etwas, Häuptling: Wenn mir das alles gelingt, dann möchte ich dich bitten, daß du uns mit deinen Leuten hilfst, das aufgelaufene Schiff von der Sandbank abzubergen.“
Coanabo schluckte hart. Er sah sein Enkelchen an und nickte wieder.
„Was ist, wenn es dir nicht gelingt?“ fragte er dann.
„Dann weiß ich auch nicht weiter“, sagte der Kutscher. „Aber ich werde mir die größte Mühe geben.“
„Falls es nicht gelingt“, sagte Coanabo drohend, „wird keiner deiner Wünsche erfüllt werden. Ich hoffe, du hast mich verstanden.“
„Ich hoffe, wir haben uns verstanden“, erwiderte der Kutscher, wobei er auf das Wörtchen „wir“ eine ganz besondere Betonung legte.
Coanabo gab keine Antwort. Aber er nickte zustimmend.
Von nun an umgab sich der Kutscher mit einer geheimnisvollen Atmosphäre. Ein bißchen Brimborium gehörte nun einmal zu einem solchen Ritual, das wurde fast erwartet. Der Medizinmann der Arawaks war sicher auch einer von der geheimnisvollen Sorte, warum sollte er da als weißer Medizinmann nicht nachziehen?
In diesem Fall war der Kutscher ein guter Psychologe. Von ihm erwartete man große Medizin. Sollen sie haben, dachte er.
Natürlich würde er nicht einbeinig herumhüpfen und beschwörende Lieder singen oder Zaubersprüche aufsagen. Er würde die Burschen ganz anders beeindrucken.
„Zunächst einmal“, sagte er, „müssen die Gaffer verschwinden, die stören mich bei der Arbeit nur. Ich mag keine Zuschauer. Selbstverständlich schließt das dich und die Mutter des Jungen aus.“
Als der Kleine wieder halb erstickt zu wimmern anfing, scheuchte Coanabo die Gaffer weg und schickte sie zu jener Stelle, wo die Mangrovenwälder begannen. Von dort aus konnten sie zusehen.
Ausnahmslos alle gehorchten sofort und verschwanden.
„Jetzt brauche ich meine beiden Assistenten“, sagte der Kutscher.
„Was sind Assistenten?“ fragte der Häuptling unsicher.
„Meine Helfer, die jungen Medizinmänner.“ Der Kutscher deutete auf Philip und Hasard, die sich eisern das Grinsen verbissen, als sie zu „jungen Medizinmännern“ ernannt wurden.
Was der Kutscher damit bezweckte, war auch den anderen klar. Wenn Hasards Söhne, jung, wie sie waren, ihm zur Hand gingen und assistierten, wurde der Häuptling sehr erstaunt sein.
Aber der Kutscher bezweckte auch noch etwas anderes damit. Die beiden waren pfiffig und bewahrten kühle Köpfe, auch in sehr heiklen Situationen, wie diese eine war. Oft genug auch hatten sie ihm assistiert, wenn er Verletzungen versorgt hatte. Die Burschen kannten keine Angst, und sie rannten auch nicht weg, wenn einmal Blut floß. Sie waren genau die richtigen für ihn.
Coanabo glaubte tatsächlich, sich verhört zu haben, als der Kutscher auf die Zwillinge deutete. Diese jungen Burschen hatten schon vorhin sein Interesse erregt, denn einer sah aus wie der andere. Zudem hatten sie solche eisblauen Augen, wie er sie noch nie an einem Menschen gesehen hatte.
„Das sind deine Helfer?“ fragte er ungläubig.
„Ja, sie lernen noch, aber ohne sie komme ich nicht aus, denn es wird sehr schwierig werden.“
Die Worte brachten Coanabo erstaunlich schnell in die Wirklichkeit zurück. Hier ging es um das Leben seines Enkelkindes, und da durfte er nicht länger zögern, wenn der weiße Medizinmann seine Helfer dringend brauchte.
Ohne zu zögern, nahm Coanabo das Messer, schritt auf die Bäume zu und zerschnitt die Fesseln von Philip, wobei er ihn neugierig musterte.
Dann war Hasard an der Reihe, und alle beide rieben sich die Handgelenke. Sie waren noch nicht richtig frei, als sie auch schon die Holzkiste mit den Instrumenten holten.
Die junge Frau hielt immer noch den Jungen. Weit im Hintergrund standen reglos die Indianer und sahen aus der Ferne zu, was da am Strand geschah. Auch Coanabo stand da, hoch aufgerichtet überblickte er mit einer gewissen Neugier die Szene. Auf den Zwillingen blieb sein Blick immer wieder hängen.
Aber er ließ auch den Kutscher nicht aus den Augen, den schmalbrüstigen, energischen Mann, der ein so sicheres Auftreten hatte. Das beeindruckte ihn am meisten. Dieser Mann war nicht hitzig, sondern blieb meist kühl, bis auf das Gebrüll, das er veranstaltet hatte, als ihm seine Instrumente entwendet worden waren. Da hatte er einen Tobsuchtsanfall gekriegt.
Coanabo sah das jetzt jedoch ganz anders. Der weiße Medizinmann brauchte diese funkelnden Geräte, um damit das Leben seines Enkels zu retten und das vieler anderer Menschen. Das war etwa so, als würde man seinem Medizinmann das Rauchpulver, die Knochenstücke oder die anderen – Gerätschaften wegnehmen, um damit zu spielen.
„Das hier ist eine verdammt ernste Sache“, erklärte der Kutscher, „und auf euch beide kommt es wesentlich an, das habe ich nicht nur so zum Spaß gesagt. Entzündet jetzt zuallererst einmal ein Feuerchen. Das brauche ich, um das lange Skalpell zu erhitzen, damit es sauber ist. Flint und alles andere findet ihr bei dem Zeug, das die Burschen uns geklaut haben. Holz liegt auch genügend herum. Es soll nur ein kleines Feuerchen werden. Alles klar?“
Читать дальше