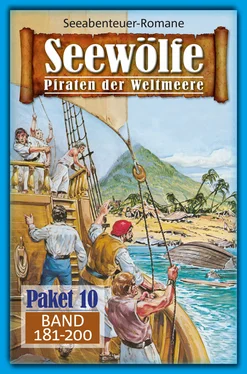„Aber gern, zumal die doch nur ein paar Nüsse mitgenommen haben. Sehen wir uns das mal an. Die anderen Burschen können sich ganz nach Belieben über die Insel verteilen.“
Der Profos, Ben, Sinona und noch ein weiterer Spanier folgten dem Pfad, der weiter landeinwärts führte.
Sinonas Schritte wurden immer langsamer.
„Soll ich dich tragen, Generalkapitän?“ erkundigte sich der Profos liebenswürdig.
„Ich bin etwas erschöpft, Sir.“
„Ach ja, er hat den ganzen Vormittag Brotfruchtbäume eingebuddelt. Kein Wunder“, sagte Ed. „Aber jetzt wünsche ich, daß du deine Flamencostelzen etwas schneller bewegst, was, wie?“
Zügig ging es weiter, bis sich die kleine Lichtung ihren Blicken im Mondlicht bot.
Daß hier Spanier gehaust hatten, war deutlich zu sehen. Man sah es noch an den Überresten der Hütten, von denen nur noch die kleinen Pfähle standen. Die Palmen im ganzen Umkreis der Behausungen waren gefällt worden, und ihre Stämme hatten die Hütten zertrümmert, so daß sie unbewohnbar waren.
Pflanzen waren zertreten und verwüstet worden, es sah aus, als hätte hier eine Horde Vandalen gewütet.
Carberry und Ben Brighton sahen sich an. Sinona stand mit gesenktem Kopf daneben und sprach kein Wort.
„Gut gemacht“, lobte Ed. „Ihr seid wenigstens gründlich gewesen, das schätze ich an euch Burschen immer so. Na, ihr habt ja Zeit genug, das alles wieder in Ordnung zu bringen.“
„Man sollte es nicht für möglich halten“, sagte Ben. „Dafür müßte jeder einzelne von euch hundert Schläge mit der Neunschwänzigen erhalten. Gehen wir wieder zurück!“
Sinona schlich mit hängenden Ohren hinter ihnen her, bis sie nach einer Weile wieder den Strand erreichten.
Dort standen die Spanier immer noch herum und wußten nicht so recht, was sie beginnen sollten.
„Die Kerle haben alles verwüstet“, sagte Ben zu Tucker. „Alle Hütten kurz und klein geschlagen, sogar die Kokospalmen haben sie gefällt, um die Nüsse zu ergattern. Segeln wir zurück, die Burschen öden mich an, wenn ich sie nur sehe.“
„Was soll jetzt aus uns werden?“ fragte Sinona kläglich.
„Ihr habt alles, was ihr braucht. Frisches Trinkwasser, jede Menge Früchte, eine Insel und die große weite See. Das Wetter ist auch bestens, was wollt ihr mehr? Hier hängt es sich besser herum als bei uns an der Großrah“, sagte Carberry.
„Ihr verdammten Läuseknacker!“ rief der alte O’Flynn. „Das nächste Mal überlegt ihr euch gefälligst, wie man sich benimmt, wenn man eine bewohnte Insel anläuft.“
Sie schoben das eine Boot etwas tiefer ins Wasser, nahmen die Leine und wollten das andere daran befestigen, um es nachzuschleppen.
Sinonas Unterkiefer klappte herab.
„Das ist unser Boot, Sir“, wagte er zu sagen.
Carberry fuhr herum und ging einen Schritt auf ihn zu.
„Sag das noch mal, du Wanze!“ drohte er. „Das war einmal euer Boot, oder glaubt ihr, wir lassen es hier, damit ihr morgen früh wieder auf den anderen Inseln herumgeistert?“
Unter den Spaniern klang Murren auf, als sie hörten, daß das Boot mitgenommen werden sollte.
„Ohne Boot können wir nicht mal fischen!“ rief einer.
Carberry wollte den Kerlen gleich zeigen, wo die Glocken hingen, damit keine falsche Stimmung aufkam.
Er ging auf den Sprecher zu, fegte ihm mit einem Schlag seinen Kupferhelm vom Schädel, den er immer noch trug, und schlug ihm links und rechts die flachen Hände um die Ohren. Der Don wackelte erst zur einen Seite, dann fing er sich wieder, kriegte das andere Ding und landete in hohem Bogen in dem weichen Sand.
„Will noch jemand das Boot?“ fragte der Profos. „Oder wollt ihr die Fische lieber mit der Hand fangen?“
Niemand muckte mehr auf. Sie hatten gesehen, wie rigoros dieser narbige Kerl immer vorging. Obwohl sie stark in der Überzahl waren, muckste sich niemand mehr.
Auch Sinona sagte nichts, aber in seinen Augen glomm jetzt der Haß, und er knirschte vor hilfloser Wut mit den Zähnen. Er fühlte sich gedemütigt und bestraft von diesen Engländern, und er wandte sich hastig ab, um seinen Haß nicht zu zeigen.
Eines Tages, dachte er, wird sich das Blättchen wieder drehen, und dann ging es diesem Seewolf und seinen Kerlen an den Kragen.
Die sechs Seewölfe nahmen in dem Boot Platz, setzten das Segel und schleppten das andere Boot hinter sich her.
Die leichte Brise trieb sie schnell vom Ufer weg. Bald waren sie nur noch Schatten, die übers Wasser glitten.
„Eigentlich ist es nicht richtig“, sagte Luke Morgan unterwegs, „daß wir diese Satansbrut auf der herrlichen Insel angesiedelt haben. Die sind doch direkt im Paradies gelandet.“
„Hast du denn eine bessere Lösung?“ fragte Ben Brighton.
„Nee, die hab ich auch nicht.“
„Na also! Uns blieb gar nichts anderes übrig. Jedenfalls können sie dort kein Unheil mehr anrichten, auch wenn die geflüchteten Insulaner vorerst nicht mehr zurückkönnen. Wir werden morgen, bei Tagesanbruch, versuchen, Kontakt mit dem Inselhäuptling aufzunehmen, um ihm das zu erklären.“
„Die halten uns doch auch für Spanier oder Kerle, die sie nur ausplündern wollen.“
„Das hängt von der Taktik ab, mal sehen. Ich bin sicher, daß sie uns längst beobachtet haben.“
Der Mond war ein ganzes Stück weitergewandert, als endlich die Silhouette der „Isabella“ wieder auftauchte.
Ben Brighton meldete sich an Bord zurück und berichtete dem Seewolf, daß alles erledigt sei.
Sie waren tatsächlich beobachtet worden. Die Späher des Papalagi ließen die Vorgänge auf der Insel keine Sekunde lang aus den Augen. Über jede Einzelheit wurde ihm berichtet.
Die Verwunderung des Papalagi wurde immer größer.
„Sie sind Brüder“, sagte er, „und sie sind doch keine Brüder, denn sie bekämpfen sich gegenseitig. Wenn ihre Gebeine morgen in der Sonne bleichen, wird man keinen Unterschied zwischen ihnen feststellen können. Jene gruben die Brotfrucht aus, die anderen zwangen sie, sie wieder einzugraben. Noch verstehe ich das nicht.“
Vergebens sann der Papalagi darüber nach, was die Fremden wohl bewog, die Gestrandeten auf die andere Insel zu bringen.
Die Aualuma hatten sich jetzt zur Ruhe begeben, nur die jungen Männer und die beiden alten Frauen hockten noch im Halbkreis um den Papalagi herum und redeten.
Es war die Art des Papalagi, lange zu schweigen, dann laut zu überlegen und diese Gedanken schließlich den anderen mitzuteilen.
Aber er wurde aus den Fremden nicht schlau. Ihre Schiffe glichen sich, von den Fremden sah einer aus wie der andere, und man konnte sie nur durch die blinkenden Helme unterscheiden.
Das eine Schiff war durch die Kraft der Götter gestrandet und total beschädigt, aber die anderen dachten nicht daran, jenen Gestrandeten zu helfen, sie bei sich aufzunehmen, wie es nach einem solchen Unglück selbstverständlich war. Statt dessen brachten sie sie nach Mooreá und überließen sie dort sich selbst.
Leise flehte der Papalagi um den Beistand der Inselgötter, damit sie seinen Verstand schärfen mögen.
Länger als eine Stunde hockte er da, still, in sich versunken, als schliefe er.
Der Mond war weitergewandert, die blitzenden Löcher im Himmel erschienen, und das Boot von Mooreá war längst wieder zurück.
Tiefe Stille herrschte, sie lag wie ein Schleier über der Landschaft. Es war eine tiefe Ruhe, die auch auf den Papalagi übergriff.
Erst als die zahnlose Alte sich leise räusperte, wurde diese tiefe Ruhe unterbrochen, und der Papalagi blickte hoch.
„Sie sehen nur wie Brüder aus“, sagte er leise. „Sie müssen von verschiedenen Stämmen abstammen, denn die einen sind böse, die anderen sind gut. Sie haben nichts zerstört, sie haben uns die Früchte zurückgegeben. Vielleicht war es ein Trick der Bösen, die Guten zu überrumpeln, und jene haben es gemerkt. Suala, der Gott des Mondes, sagt mir, daß sie uns suchen werden, sobald es hell wird.“
Читать дальше