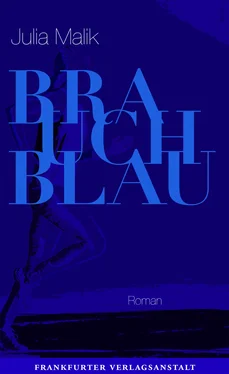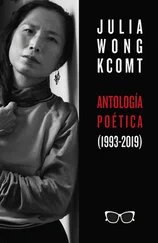Sie reibt sich die Augen. Alles ist weiß. Ein Mann beugt sich über sie und kippt ihr Wasser ins Gesicht. Er ist vermutlich die Reinigungskraft, oder wie nennt man ihn, vielleicht Roomboy? Und da ist ja auch wieder dieses Zimmer mit den Kleiderbergen und den hellblauen Federn. Sie muss zu den Kindern, aber dieser Mann hält immer noch ihr Gesicht fest. »Ich rufe einen Arzt«, sagt er und verlässt das Zimmer.
Sie muss sich beeilen, sie muss hier weg. Das Ziehen durch den ganzen Körper, das kennt sie doch, das Gefühl, immer für die Kinder da zu sein, sich um sie zu kümmern. Der Schmerz um Herbert hatte genau das in ihr verbrannt.
Kurz reißt alles auf. Wo sind die Kleinen? Was, wenn sie sie nicht findet? Sind sie geklaut oder überfahren worden oder verhungert? Sie kriegt keine Luft. Sie muss atmen, die Türen aufstemmen, irgendwo dahinter ist noch alles da, oder? Dahinter ist alles gut. Es war doch immer gut.
Sie weiß, sie hat sie ins Bett gebracht. Das war aber nicht dieses hier, das waren zwei Betten nebeneinander.
Sie muss sehr genau nachdenken, fein die trockenen Wände abkratzen, irgendwo ist da eine Lücke, wo sie dazwischenkann, sie muss sie finden.
Aber erst einmal kommt dieser Hotelarzt. Die können sie doch nicht einfach festsetzen und untersuchen. Sie muss die Kinder finden. Es geht hier nicht um ihre Schmerzen, und sie kann es diesem Arzt leider unmöglich recht machen, sie kann es niemandem mehr recht machen, sie muss sofort in ihr Leben, ihr richtiges Leben zurück.
FLUR
Sie kriecht zu dem Klamottenberg, zerrt einen Seidenlappen heraus und sich über die Nase. Blumendruck, hellblaue Federn an den Ärmeln und unten am Rocksaum. Das wird den Kindern gefallen. Ein langer weißer Pelz glotzt sie aus der Ecke an. Woher kennt sie den? Sie watet durch ihre Gedanken.
Keine Zeit! Sie braucht Schuhe. Hier sind aber keine, weit und breit nicht. Sie schiebt sich an der Wand nach oben.
Die Beine stolpern los. Sie reißt die Zimmerkarte aus der Halterung, dann schlägt die Tür hinter ihr zu. Man müsse auch mal eine Tür hinter sich schließen, dafür gingen dann drei neue auf, sagt Larry. Er ist ihr bester Freund und kennt sich mit Türen aus, oder eher mit Ausgängen? Hier sind viele Türen. In welche Richtung soll sie gehen? Für ein Ausschlussverfahren reicht ihre Kraft nicht.
Gerade öffnet sich eine Tür, genau neben ihr. Ein Mann mit Anzug und Rollkoffer tritt auf den Flur. Sein Blick rutscht zu ihren nackten Füßen. Sie wankt, starrt ihn an. Sie will losgehen, taumelt aber und hält sich an der Tür fest. Sein Blick surrt von ihren Füßen die Beine hoch, Federkleid, Pelz, Blut an der Stirn. Ihr Mund zieht sich zusammen. Nur noch mal kurz an der Wand anlehnen. Die Übelkeit ist aufdringlich. Sie muss heruntergeschluckt werden. Sie sieht zu dem Mann, er weicht ihrem Blick aus. Sie geht auf ihn zu, schlingert, bleibt aber aufrecht. Sie weiß nicht, wo sie anfangen soll. Sie hört ihre Kinder rufen. Ihre Stimmen schnüren ihr die Kehle ab. Der Mann steht im Türrahmen, hat noch einen Fuß in der geöffneten Tür. Sie hält sich an ihm fest. Er weicht nach hinten aus, sie greift nach seinem Gesicht. Er wehrt sich, aber sie lässt nicht los, die Zeit drängt. Sie kann doch nicht barfuß durch die Stadt.
»Los. Ich brauch deine Schuhe.«
Er lacht. Hoch und hüstelnd.
»Wer bist du denn?«, fragt er, grinst verlegen.
Was geht den das an. Wo sie es doch selbst nicht mehr weiß.
»Sag doch Schnulli«, antwortet sie ungeduldig.
»Das ist doch kein Name«, sagt er.
Sie dreht den Kopf zur Seite, atmet ein und sagt dann, mit Blick in sein Gesicht: »Mag sein. Ich muss los, jetzt mach mal.«
»Was?« Er lacht schon wieder. »Haha. Na ja, die passen dir bestimmt nicht. Was hast du denn für eine Schuhgröße?«
Sein Atem löst ihren Würgereiz aus.
»Zweiundvierzig«, antwortet sie. Schaut sich seine Schuhe an. Sie sind schwarz und klobig.
»Passt eh nicht«, erklärt er zufrieden.
»Ist egal«, sagt sie schnell.
»Die waren nicht ganz billig«, fährt er fort. »Wirklich nicht. Fünfhundertvierzig Euro. Oder du gibst mir das Geld. Ich kann sie dir ja verkaufen.« Er kichert, begeistert von seiner Idee.
Sie starrt ihn an.
»Vergiss es, ich bin momentan nicht zahlungsfähig. Meine Kinder erziehe ich allein. Mein Mann lebt mit einer anderen Frau zusammen.
Um 6 Uhr weckt mich eines der Kinder, das andere schläft ausgerechnet dann länger.
Ich muss:
Um 9 Uhr Kinder in die Kita bringen.
Um 9.30 Uhr Essen im Supermarkt klauen.
10–13 Uhr, Stimm- und Repertoirearbeit, ich bin Opernsängerin. Leider seit über einem Jahr ohne Engagement. Aber es kann ja jederzeit wieder losgehen. Also Tonleitern, Intervalle.
13–15 Uhr, Arien auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch. Üben, bis man jeden Ton im Dunkeln kennt und sich blind in den Liedern zurechtfindet. Manchmal wird sehr spontan, also ein paar Stunden vor dem Auftritt, besetzt, weil jemand ausfällt, und dann muss man das Repertoire perfekt können.
Ich muss:
Immer auf Abruf sein, auch im Schlaf.
Mich ständig im Schlaf treten lassen. Im Wachen anbrüllen lassen.
Immer etwas zu trinken dabeihaben.
Ununterbrochen die Gefühle der Kinder aushalten.
Wutanfälle, Trauer, Schmerzen.
Immer, also wirklich immer, ein Ohr bei den Kindern haben.
Ständig aufpassen.
Bei Kälte Jacken und Mützen gegen den Willen der Kinder anziehen.
Sonnencreme gegen ihren Willen auftragen oder zwei Stunden diskutieren.
Entscheiden, wann im Streit der Kinder der Punkt ist, wo man eingreifen muss.
Alles, was die Kinder sammeln, mitschleppen.
Überhaupt schleppen, alles gleichzeitig:
Einkäufe,
weinende Kinder,
vor Wut brüllende und tretende Kinder,
Laufräder,
Schlitten,
Kinderrucksäcke.
Dann muss ich:
Wäsche waschen,
Wäsche falten,
Kinderzimmer aufräumen,
alle Zimmer aufräumen,
staubsaugen,
Töpfe abspülen,
kochen und noch mal kochen.
Gut gelaunt sein.
Nicht zu oft vor den Kindern weinen.
Singen oder auch nicht singen, je nach Laune der Kinder.
Geschichten erzählen, Geschichten vorlesen.
Zuhören, was die Kinder erzählen, obwohl man etwas anderes denken und etwas anderes tun muss.
Zuhören und so tun, als ob man es versteht.
Sich dafür schämen.
Unendlich geduldig sein.
Alles erklären.
Verkatert Frühstück machen.
Verständnis haben.
Immer in den eigenen Gedanken unterbrochen werden.
Immer den eigenen Rhythmus von jemand anderem bestimmen lassen.
Lego bauen.
Stifte anspitzen.
Fünftausendmal die gleichen Spiele spielen.
Lieben, lieben, lieben.
Grenzen respektieren.
Eigene Grenzen setzen.
Eigene Grenzen immer wieder übertreten lassen.
Einkaufen.
Kochen.
Waffeln backen.
Hintern abwischen.
Kotze aus der Bettwäsche und den eingepinkelten Hosen waschen,
Betten beziehen.
Staubsaugen.
Arien üben, die außer mir vermutlich kein Mensch je hören wird, täglich siebenhundert Bewerbungsbriefe abschicken.
Fingernägel schneiden.
Ponys schneiden.
Lustige Drachen aus Transparentpapier basteln.
Kuscheltiere nähen und hinterher die ganzen Schnipsel wegfegen, angemalte Steine und festgeklebte Nudeln aufsammeln, den Boden sauberlecken, weil mir das Wasser abgestellt wurde.
Den ganzen Kitamassenmailzirkus verfolgen.
Ritterburgen und Zoos aus Kaplasteinen bauen, Bausteine, die ich nicht mal kenne, du Arschloch«, sagt sie dem Mann. »Los, Schuhe aus!«
Der Aufzug glänzt verschwommen. Sie weiß nicht, warum sie weint. In kleinen Schrittchen stemmt sie sich über den Teppich. Die Schuhe sind wirklich zu klein. Aber sie kann gehen. Ihr ist so übel. Sie merkt, wie die Angst sich in ihr formt, sie sieht Kinderhände, aber die Körper fehlen, einzelne Hände, sie kann sie nicht zusammenkriegen.
Читать дальше