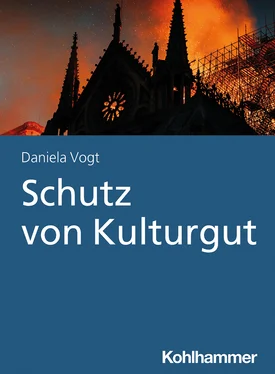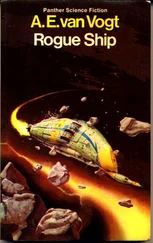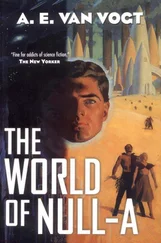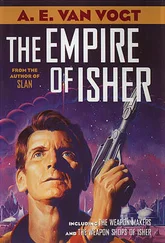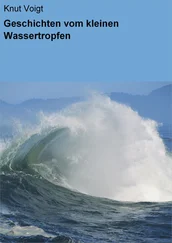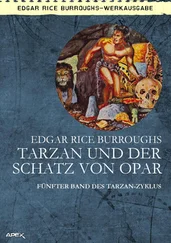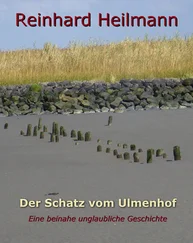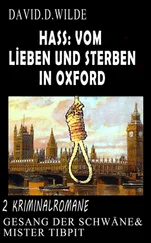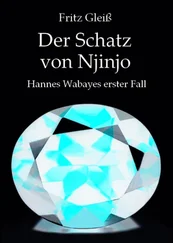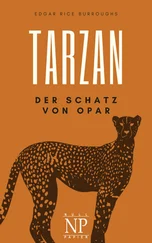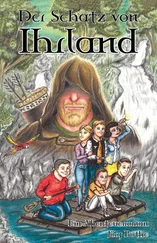Bild 4: Blick auf Avignon, Kulturhauptstadt im Jahr 2000.
Das »Europäische Kulturerbe-Siegel« wird seit 2013 an Stätten »mit grenzüberschreitendem oder gesamteuropäischem Charakter« verliehen. Die Stätten werden von Land zu Land nach unterschiedlichen Maßstäben ausgewählt, wobei festgelegte Kriterien die Auswahl bestimmen. Demnach sind Stätten auszuzeichnen, die »Symbole und Beispiele der europäischen Einigung, der Ideale und der Geschichte der EU sind«. Der symbolische wie der pädagogische Wert der Stätten für Europa wiegen für die Auswahl mehr als kunsthistorische oder Denkmalschutz-Kriterien, denn das Kulturerbe-Siegel soll bestehende Kulturerbe-Initiativen ergänzen, z. B. die UNESCO-Welterbe-Liste, die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit und die Initiative »Kulturwege Europas« des Europarats. Doppelauszeichnungen sollen in jedem Fall vermieden werden. Des Weiteren werden seit 1985 die »Tage des europäischen Kulturerbes« ausgerichtet. Lokale Kulturstätte werden an jenen Tagen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die normalerweise verschlossen sind.
Weder im Einigungsvertrag noch in einem der vorgestellten Programmen werden konkrete Kriterien zur Bestimmung des europäischen Kulturerbes benannt. Neben der Betonung der europäischen Vielfalt ist zugleich die Herausstellung europäischer Werte und Gemeinsamkeiten in der Identitätsfindung Europas zu beobachten, [30]deutlich hervorgehoben durch das europäische Motto »In Vielfalt geeint«. Interessant ist die Zusammenarbeit alter Kulturregionen über die nationalen Grenzen hinweg, die oftmals durch Kriege und neue Grenzziehungen immer wieder geteilt wurden. Bestes Beispiel bietet hier Trentino-Südtirol-Tirol.
1.3 Zur Definition von Kulturgut
Kultur wirkt bei näherer Betrachtung sehr komplex und wenig fassbar. Es drängt sich die Frage auf, ob überhaupt von einer nationalen oder regionalen Kultur als geschlossenem und homogenem Kollektiv gesprochen werden kann, insbesondere bei Einbeziehung vieler heterogener Subkulturen. Was sich von außen betrachtet als homogen erweist, erweist sich bei näherem Hinsehen als sehr heterogen.
Auch der Begriff Kulturgut ist nur schwer zu präzisieren, was sich unter anderem darin zeigt, dass es keine allgemein gültige Definition gibt. Dies unterstreichen die internationalen Begriffsbestimmungen zum Kulturgut, die in Abhängigkeit zum Schwerpunkt des jeweiligen Abkommens, zurückgehen auf die Kriterien in Artikel 1 der Haager Konvention (1954). Diese sehr allgemein gehaltenen Kriterien bieten zum einen großen Interpretationsspielraum und zugleich Mindeststandards für die Bestimmung eines Kulturguts. Zumeist präzisiert ein unabhängiges Gremium von Sachverständigen den Einzelfall. Die Entscheidung durch Gremien anhand festgelegter, sehr allgemeiner Kriterien, ist in erster Linie wissenschaftlich begründet und schließt daher häufig die breite gesellschaftliche Meinung aus. So löste die Nominierung von Schloss Neuschwanstein als deutsche UNESCO-Welterbestätte in akademischen Kreisen Empörung, in der Öffentlichkeit Begeisterung aus.
Wert und Symbolik von Kultgütern wandeln sich mit der Zeit in Abhängigkeit von Gesellschafts-, Politik- und Wirtschaftssystemen. Sowohl der Erhaltungszustand, das nähere Umfeld und/oder wissenschaftliche Erkenntnisse verändern sich als auch die Wertung und die Entscheidung über den Schutz. Grundsätzlich gilt, dass sämtliches Kulturgut schützens- und erhaltenswert ist. Jedoch gibt jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft den Dingen eine eigene Wertigkeit bzw. Wichtigkeit. Je nachdem wie sehr sie sich mit dem Gut identifiziert – denn: Die eigene Kultur und ihre Ausdrucksweisen geben Sicherheit in der wilden, ungeordneten Welt. Dieser Bedrohung durch wilde Natur Herr zu werden, geschieht auch durch Anpassung an die lokalen, geographisch-klimatischen Gegebenheiten. So ergibt sich ein sehr universelles Verständnis, was bedeutend und schützenswert ist. Doch wovor sind Kulturgüter zu schützen und welche Bedrohung wird zu einer ernsthaften Gefahr? Kann Kulturgut so umfassend geschützt und erhalten werden, und wenn ja, wie?
[31]Die Bedeutung von Kulturgut ergibt sich:
aus dem Zeitgeist,
aus der Einmaligkeit (Unikate), Echtheit, Unversehrtheit,
aus dem materiellen wie immateriellen Wert (Symbolik).
Sie haben lokale, regionale, nationale und/oder globale Bedeutung bzw. Strahlkraft.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.