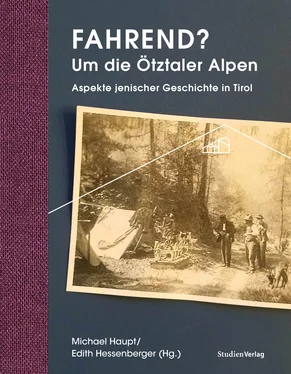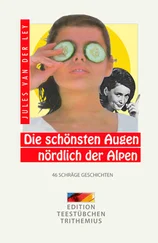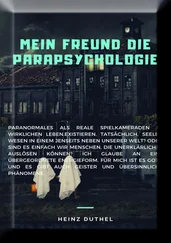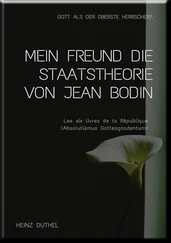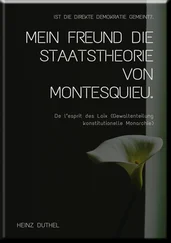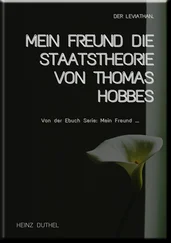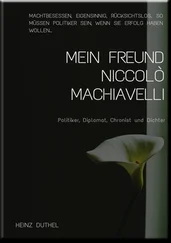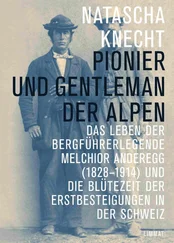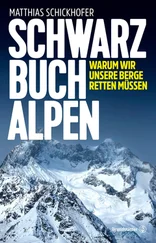Wie viele Tiroler*innen – es waren vorrangig Männer – auf diese Weise außer Landes unterwegs waren, ist unklar. Eine Schätzung für das 18. Jahrhundert geht von rund 30.000 aus, eine Erhebung in den Jahren 1811/1812 zählte 27.800 (bei einer Gesamtbevölkerung von rund 700.000 Personen). Wesentlich ist, dass die beschriebene saisonale Mobilität keineswegs ohne Weiteres immer als Folge von Überpopulation und ungenügenden Erträgen aus der Landwirtschaft sowie einer allgemeinen wirtschaftlichen Krise zu interpretieren ist: „Die Subsistenzsicherung durch Mehrberufigkeit stellte […] den ‚Normalzustand‘ dar“, und vor allem hinsichtlich des Wander- bzw. Hausierhandels mit heimgewerblich gefertigten Produkten, dessen Bedeutung im 18. Jahrhundert anwuchs, erklärt Ammerer, dass diese Wanderungen durchaus als „Karrieremöglichkeiten bzw. Chancen für ein ‚besseres Leben‘“ betrachtet wurden. 47
„Tyroler“ und „Tyrolerin“ im frühneuzeitlichen Europa
„Da in großer Anzahl vor allem Männer […] auf Handelswanderschaft gingen, waren neben den Savoyarden die Tiroler schon den Zeitgenossen weithin ein Begriff“, 48 so Gerhard Ammerer. 49 Die Eindrücke, die Tiroler*innen auf ihren Reisen hinterließen, fanden als Stereotype auch Eingang in die Literatur. 50 Eines der wohl bekanntesten Beispiele in dieser Hinsicht ist Heinrich Heines bissiger Kommentar über die Tiroler*innen, der ganz selbstverständlich voraussetzte, dass seine Leser*innenschaft „diese bunten Deckenverkäufer, diese muntern Tiroler Bua, die wir in ihrem Nationalkostüm herumwandern sehen“, kannte. 51
Diese Stereotype wurden von Tiroler Händler*innen und Dienstleister*innen auch selbst zu Vermarktungszwecken aufgegriffen. Sie antizipierten gewisse Erwartungshaltungen ihres Publikums, wie z. B. aus einer zeitgenössischen Replik auf den Spott Heines hervorgeht. 52 Dieser wiederum ortete bereits 1828 den kommerziellen Ausverkauf tirolerischer Eigenarten im Ausland und führte dabei die bekannte Zillertaler Sängerfamilie Rainer, die mit ihren Auftritten in Deutschland, England und sogar Nordamerika Tirol weithin bekannt machte, als Beispiel an. 53 Ganz ähnlich inszenierte Felix Mitterer Ende des 20. Jahrhunderts einen Zillertaler Wanderhändler des ausgehenden 18. Jahrhunderts: In seinem Stück „Das wunderbare Schicksal“ erblickte er im Handschuhhändler

Abb. 7: Ein mobiler Teppichhändler um 1775, hier auf einem etwas jüngeren colorierten Nachdruck aus Johann Christian Brands Sammlung von „Zeichnungen nach dem gemeinen Volke besonders Der Kaufruf in Wien“ Peter Prosch, der als „Hoftyroler“ im süddeutschen Raum bekannt war und 1789 seine Lebenserinnerungen veröffentlichte, 54 „den ersten Fremdenverkehrstiroler“. 55
Im vorliegenden Beitrag wurde versucht, einen knappen Überblick über einen als Migrations- bzw. Mobilitätsgeschichte Tirols in der Frühen Neuzeit nur überaus grob umrissenen Themenkomplex zu vermitteln. Einzelaspekte konnten dabei lediglich gestreift werden. Offensichtlich wurde dennoch, dass es sich um ein vielfältiges und keineswegs randständiges Thema handelt. Das historische Tirol fungierte sowohl als Destination als auch als Ausgangsregion für unterschiedlich motivierte Wanderungsbewegungen, die in verschiedenen Quellen ihren Niederschlag fanden. Die Berücksichtigung dieser beiden Perspektiven erscheint zentral für die Migrationsgeschichte einer Region. Die sicherheitspolizeilichen Maßregeln und wirtschaftlichen Bedenken gegenüber äußeren Einflüssen werden durch den Eindruck einer überaus mobilen Gesellschaft konterkariert. Tiroler Migrant*innen, die in ganz Europa spätestens ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Bekanntheit erlangten, waren wesentlich an der Konstruktion eines Bildes von Tirol als romantisiertem Sehnsuchtsort im 19. Jahrhundert beteiligt, das bis heute nachhallt. Dass dieses Bild zuweilen mit besonders ausgeprägter Sesshaftigkeit und Verwurzelung der Tiroler*innen mit ihrem Heimatland verbunden zu werden scheint, ist bemerkenswert.
__________________
1Hahn 2012, S. 9f. Vgl. dazu auch das mit „Migration – eine historische Normalität“ überschriebene Schlusskapitel von: Holenstein et al. 2018, S. 347–360. Zur zunehmenden Sesshaftwerdung im 20. Jahrhundert z. B. auch: Althammer 2017, S. 23f.
2Hahn 2012, S. 16, 41, 86f. u. 123f. Die Stereotypenbildung und deren Ausnützung durch die Tiroler*innen selbst erwähnt zum Beispiel bereits Heine 1834, S. 70–72. Kürzlich aufgegriffen und auf die Herausbildung von „Typen“ in Wien umgelegt wurde dieses Motiv der sich außerhalb der Landesgrenzen selbst vermarktenden Tiroler*innen von: Wietschorke 2013. Zur Dominanz der agrarischen Arbeitsmigration in der frühen Neuzeit siehe z. B. Noflatscher 2002.
3Eine Ausnahme ist etwa die Verheiratung adeliger Töchter ins Ausland: TLO 1573, Buch 3, Titel 34.
4Schmeller 1836, S. 415f.
5Robert Büchner hat sich in seinem Buch über Tiroler Wanderhändler eingehender mit den zeitgenössischen Begrifflichkeiten beschäftigt. Er berichtet beispielsweise davon, dass etwa auch Händler aus den Fürstbistümern Trient und Brixen mitunter als „Savoyer“ bezeichnet werden konnten, der Begriff also als Synonym für fremde Wanderhändler insgesamt verwendet wurde. Ganz ähnlich verhielt es sich mit den „Schotten“ oder auch den „welschen Krämern“: Büchner 2011, S. 72–83.
6Die unlauteren Methoden, die bei – vor allem auswärtigen – Spezereihändlern befürchtet wurden, sind zum Beispiel beschrieben in der TLO 1573, Buch 6, Titel 12. Im Kern gleichlautend – das gilt ebenfalls für die im Folgenden zitierten Passagen – auch die Landesordnung von 1532: TLO 1532, Buch 6, Titel 12.
7TLO 1573, Buch 6, Titel 13, §§ 1 u. 2.
8Beim Begriff Riffianer handelt es sich nicht um eine Herkunftsbezeichnung mit Bezug auf das im Passeier gelegene Dorf Riffian. Im Tirolischen Idiotikon wird der Begriff, der so viel wie „Lotterbube“ oder „herumvagierender Spitzbube“ bedeute, etymologisch auf das italienische „ruffiano“, das mit „Kuppler“ oder „Zuhälter“ übersetzt werden kann, zurückgeführt: Schöpf und Hofer 1866, S. 177 u. 569.
9TLO 1573, Buch 7, Titel 8.
10Ebd., Titel 7. In der Landesordnung von 1532 werden „Zigeuner“ und „Riffianer“ in einem Artikel zusammengefasst: TLO 1532, Buch 7, Titel 8.
11TLO 1573, Buch 7, Titel 4. In TLO 1532, Buch 7, Titel 5.
12TLO 1573, Buch 7, Titel 4.
13Vgl. zum Folgenden: Althammer 2017, S. 25–38.
14Auf die grundlegende Unterscheidung zwischen „bedürftigen“ und „unwürdigen“ Armen und deren weitläufige Folgen verweist beispielsweise auch Jütte 2000, S. 1–10.
15Althammer 2017, S. 29f. Zur Typologie von Armut verweist Althammer auf: Paugam 2008, S. 121–269.
16Althammer 2017, S. 37.
17TLA: Totenbuch Längenfeld, 05.10.1679 (MF 0797-11).
18TLA: Totenbuch Längenfeld, 22.07.1765 (MF 0799-02). Laut Peter Stöger sei Grienauer bzw. Grünauer ein auch unter jenischen Familien Tirols verbreiteter Nachname: Stöger 2002, S. 180.
19TLA: Totenbuch Längenfeld, 26.06.1772 (MF 0799-02).
20Vgl. z. B. TLA: Taufbuch Längenfeld, 12.11.1712, 18.05.1716 u. 23.02.1718 (MF 0796-01); sowie 29.04.1814 (MF 0796-05).
21TLA: Taufbuch Längenfeld, 18.05.1716 (MF 0796-01).
22TLA: Taufbuch Flaurling, „Liber Vagantium“ (MF 0758-05); sowie Taufbuch Inzing, „Liber Vagorum Baptizatorum“ [S. 220–232] (MF 0755-05); sowie Taufbuch Hatting, „Liber Vagorum Baptizatorum“ (MF 0755-01). Das Taufbuch für Inzing wurde bis 1767, jenes für Hatting bis 1786 bzw. 1788, das für Oberhofen bis 1740 und das für Pfaffenhofen bis 1784 in Flaurling, dem Sitz der Pfarre, geführt. Auffallend ist, dass vereinzelt auch Kinder von auswärtigen Soldaten und deren Frauen in diesen Listen genannt werden. Eine Überprüfung, inwiefern diese Eltern „Vagabund*innen“ waren oder zumindest zeitgenössisch als solche betrachtet wurden, steht noch aus. Schließlich könnte auch das Fehlen eines festen Wohnsitzes vor Ort grundsätzlich die Ursache für die Einordung in diese Rubrik gewesen sein.
Читать дальше