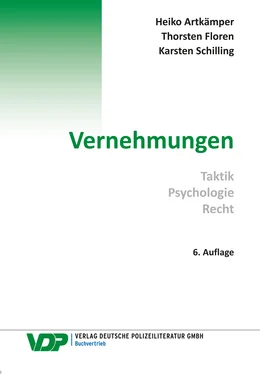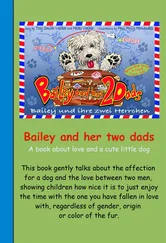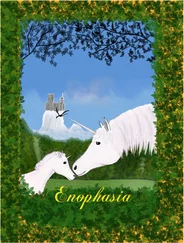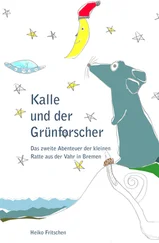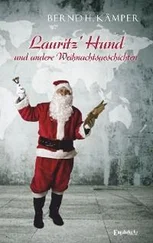Das perfekte, universell anwendbare Vernehmungskonzept für jede Vernehmungssituation und für jeden Vernehmenden gibt es nicht; ein solches kann und soll daher auch hier nicht präsentiert werden.
Vorwort zur sechsten Auflage Vorwort zur sechsten Auflage Wer fragt, bekommt Antworten – wer richtig fragt, bekommt die richtigen Antworten. Informationsakquise ist für sämtliche Berufe mit Vernehmungs- und Befragungspraxis von täglicher und essenzieller Bedeutung. Der Spagat zwischen praktischer Anwendung einerseits und gesetzlich-theoretischem Hintergrundwissen andererseits ist ungeschriebene Geschäftsgrundlage einer jeden Vernehmung. Die Tatsache, dass eine autoritär veranlasste Zwangskommunikation zur Aufklärung einer Straftat beitragen kann, soll und muss, erschwert die Kommunikation, macht sie aber nicht unmöglich. Es wurde in den Vorauflagen darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, bereits bei der erstmaligen Begehung einer Straftat aufzufallen, gering ist. Beschuldigte, die in flagranti gestellt werden, sind in aller Regel keine Erst- oder Einmaltäter. Will man im Sinne einer Qualitätsoffensive der Kriminalität konsequent und erfolgreich begegnen, ist die Vernehmung wichtiger denn je: Auch dies ist das Ziel einer gelungenen Vernehmung, die – entgegen der Wissenschaftshörigkeit mancher – weiterhin einen Kernbereich der Tätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung darstellt. Anregungen und Wünsche der Leser, die an uns herangetragen wurden, fanden – soweit möglich – erneut Berücksichtigung. Die Pensionierung von Karsten Schilling hat die Autoren dazu bewegt, „frisches Blut“ zur Aktualisierung hinzuzuziehen: Thorsten Floren tritt seit dieser Auflage sukzessive die Nachfolge an und verstärkt so den Praxisbezug. Sämtliche Änderungen wurden berücksichtigt, sodass die Veröffentlichung sich auf aktuellem Stand befindet. Dortmund/Steinheim/Unna, im Januar 2021 Heiko Artkämper Thorsten Floren Karsten Schilling
Aus dem Vorwort zur fünften Auflage (2018) Aus dem Vorwort zur fünften Auflage (2018) Anregungen und Wünsche der Leser, die an die Autoren herangetragen wurden, fanden – soweit möglich – erneut Berücksichtigung, ohne dass dadurch die Struktur gegenüber den Vorauflagen geändert werden musste.
Aus dem Vorwort zur vierten Auflage (2017) Aus dem Vorwort zur vierten Auflage (2017) Die Notwendigkeit einer Neuauflage der vergriffenen Veröffentlichung fällt in eine Zeit, in der Gesetzesänderungen zu erwarten stehen. Unter anderem der seit dem Jahr 2016 diskutierte Rohentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz – Entwurf eines Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens – könnte im Falle seiner Umsetzung zu gravierenden Änderungen betreffend die Dokumentation von Vernehmungen führen. Diese wurden – soweit möglich – in die Ausführungen integriert und werden im Zusammenhang im Kapitel 18.7 dargestellt.
Aus dem Vorwort zur dritten Auflage (2014) Aus dem Vorwort zur dritten Auflage (2014) Erörterungen zu den Grundzügen der Wahrnehmung, der Kommunikation und der Vernehmungstechnik wurden ergänzt und erweitert. Soweit die im Jahre 2013 in Kraft getretenen Änderungen der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes teilweise eigenständige Belehrungspflichten eingeführt haben, die durch ihre Aufnahme als Querverweise wenig benutzerfreundlich sind, wurden allerdings auch strukturelle Änderungen vorgenommen, die der besseren Verständlichkeit dienen sollen. Völlig neu eingeführt wurde das Kapitel zu Vernehmungen in besonderen Verfahrensarten (insbesondere Disziplinarverfahren). Hier ist es gelungen, für diese Spezialmaterien zwei kompetente und renommierte Gastautoren (POR Christoph Keller und ORR Philipp Metzger) zu gewinnen.
Aus dem Vorwort zur ersten Auflage (2010)
Übersichten/Schaubilder
1Vernehmungen im Kontext von menschlicher Erinnerung, Irrtum und Lüge
1.1Menschliches Erinnern: Grundzüge von Wahrnehmung, Codierung, Speicherung und Wiedergabe
1.1.1Fehlerquellen bei der Wahrnehmung
1.1.2Fehlerquellen bei der Codierung
1.1.3Fehlerquellen bei der Speicherung
1.1.4Fehlerquellen bei der Wiedergabe
1.2Personenbezogene Faktoren
1.2.1Weitere subjektive Determinanten
1.2.2Wahrnehmungsverzerrungen
1.2.3Alters- und Größenschätzungen
1.3Sachbezogene Faktoren
1.4Lüge und Irrtum
1.5Unglaubhaftigkeits- bzw. Nullhypothese, Realkennzeichen und Warnhinweise
1.5.1Nullhypothese
1.5.2Realkennzeichen und Warnsignale
1.6Analyse einer Aussage
1.6.1Detailreichtum
1.6.2Individuelle – ausgefallene – Besonderheiten
1.6.3Raum-zeitliche Verknüpfung mit objektivierbaren Faktoren
1.6.4Konstanz in wesentlichen Teilen
1.6.5Homogenität
1.6.6Ungeordnete – aber psychologisch erklärbare – Beschreibungen
1.6.7Spontane Erweiterungen
1.6.8Objektivität durch Beschreibung be- und entlastender Umstände
1.6.9Resümee
1.7Lügensignale
1.7.1Recht zur Lüge?!
1.7.1.1Zeugen
1.7.1.2Beschuldigte
1.7.1.3Selbstbelastungsfreiheit versus Auskunftspflichten
1.7.1.3.1Insolvenzordnung
1.7.1.3.2Asylgesetz
1.7.1.3.3Disziplinarverfahren im Strafvollzug
1.7.1.4Falschangaben bei Verkehrsdelikten
1.7.2Guter oder schlechter Leumund
1.7.3Fehlen von Realitätskriterien
1.7.4Weitere Warn- und Lügensignale
1.8Zuverlässig funktionierende Lügenerkennungsmethoden?
1.9Kurze tatsächliche Bestandsaufnahme
1.9.1Der Fall Jakob von Metzler
1.9.2Falsche Geständnisse und der Bauer Rudi Rupp
1.9.3Das Holzklotzverfahren
1.9.4Die Vermisstenanzeige
1.9.5Der wenig kooperative Beschuldigte
1.9.6Der nicht auffindbare Beschuldigte
1.9.7Ein Gegenbeispiel: Tod nach Luftembolie bei einverständlichem Geschlechtsverkehr
1.9.8Erhebungen von Habschick
1.9.9Appell an die Vernehmenden
1.10Historische Reminiszenz
1.10.1Vernehmungen
1.10.2Geständnisse beschuldigter Personen
1.11Vernehmungen im EU-Kontext
2Vernehmungen und andere Arten der Informationsgewinnung
2.1Begriff der Vernehmung
2.2„Gespräche“ zur Gefahrenabwehr
2.2.1Kommunikativer Einsatz
2.2.2Gespräch auf der Straße
2.3Gefährderansprachen oder besser: Gefährdergespräche
2.3.1„Versuch“ einer Definition aus Bayern
2.3.2Psychologisch und taktisch sinnvolle Handlungsempfehlung
2.3.3Das Interventionskonzept
2.4Handlungsempfehlungen, Opferfürsorge und Anhörungen
2.5Informatorische Befragungen
2.6Sondierungsfragen
2.7(Zufälliges) Mithören von Äußerungen
2.8Spontanäußerungen
2.8.1Spontanäußerungen von Beschuldigten
2.8.2Selbstgespräche von Beschuldigten
2.8.3Spontanäußerungen von Zeugen
2.9Vorgespräche
2.10Anzeigeerstattungen
2.10.1Rechtsnatur der Anzeigeaufnahme
2.10.2Spielregeln für den Anzeigeaufnehmenden
2.10.3Anzeigeerstatter bei Privatklagedelikten
2.10.4Anzeigeerstatter oder Beschuldigter?
2.10.5Strafanzeigen gegen Kinder
2.11Einsatz verdeckter Ermittler
2.12Heimliches Aufzeichnen von Gesprächen mit Besuchern während der Untersuchungshaft
Читать дальше