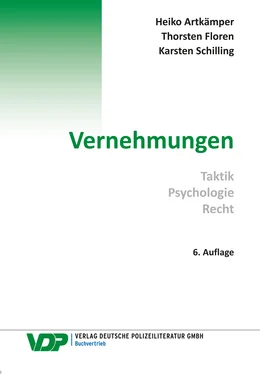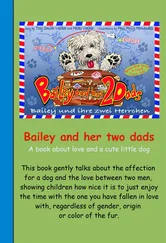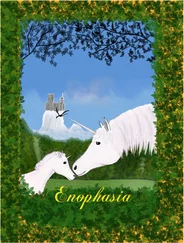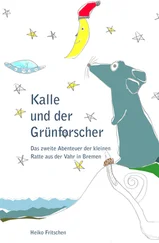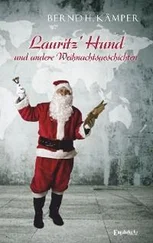79 Dem Asylverfahrensrecht ist diese Problematik ebenfalls nicht fremd – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied zu den vorgenannten Rechtsbereichen: Die im Rahmen des Asylverfahrens nach §§ 15, 25 Asylgesetz bestehende Mitwirkungspflicht des Antragstellerskann mit staatlichen Mitteln nicht erzwungen werden. Der Interessenkonflikt beschränkt sich auf die Person des Antragstellers, der vor die Alternative gestellt ist, sich entweder durch vollständigen und wahrheitsgemäßen Tatsachenvortrag der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen oder durch Verweigerung von (zureichenden) Angaben die Ablehnung seines Asylbegehrens zu riskieren. Aus diesem Konflikt kann in aller Regel kein Beweisverwertungsverbot folgen. 32§ 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Asylgesetz, der die Übermittlung und Verwertung der Angaben des Asylsuchenden auch für Maßnahmen der Strafverfolgung legitimiert, ist daher verfassungsrechtlich unbedenklich.
80 Etwas anderes kann sich dann ergeben, wenn die Anhörung im Asylverfahren an der Begründung und Erhärtung eines Anfangsverdachts ausgerichtet ist, z. B., indem die Anhörung unterbrochen wird, die Strafverfolgungsbehörden über die (strafrechtliche) Selbstbelastung des Asylbegehrenden informiert werden und sodann das weitere Vorgehen abgesprochen wird. Bei derartigen „ verdeckten Beschuldigtenvernehmungen“, die den nemo-tenetur-Grundsatz 33, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das dem Rechtsstaatsprinzip inhärente Verdikt des fairen Verfahrens tangieren, entscheidet die im Einzelfall vorzunehmende Abwägung dieser Verfassungsrechte gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an effektiver Strafverfolgung über ein etwaiges Verwertungsverbot. 34Aspekte wie ein ggf. planmäßiges Vorgehen, etwa bei standardisierter Verwendung eines für Zwecke des Strafverfahrens entwickelten Fragenkatalogs, die Tatsache, dass der Mitarbeiter des BAMF die Anhörung nicht als Privatperson oder „verdeckter Ermittler“, sondern als Behördenvertreter mit staatlicher Autorität durchführt, aber – auf der anderen Seite – auch ein drohender Beweismittelverlust spielen eine Rolle.
1.7.1.3.3Disziplinarverfahren im Strafvollzug
81 Werden gegen Insassen einer JVA Disziplinarverfahrengeführt, erfolgt regelmäßig eine Vernehmung durch Beamte des Strafvollzuges, in deren Verlauf die Betroffenen die Vorwürfe möglicherweise einräumen. Im daraufhin eingeleiteten Strafverfahren sind – so das LG Detmold – bei einem entsprechenden Widerspruch des Angeklagten dessen ursprüngliche Angaben nicht verwertbar, da die besondere Drucksituation in der JVA und die fehlende Belehrung über das Auskunftsverweigerungsrecht im Rahmen des Disziplinarverfahrens zu einem Beweisverwertungsverbot führen. 35
1.7.1.4 Falschangaben bei Verkehrsdelikten
82 Ein Fahrverbotund/oder der Fahrerlaubnisentzugnebst Sperrfristbeeinträchtigen den Beschuldigten in seiner Lebensführung und treffen ihn deshalb oftmals härter als die (eigentliche) Strafe. Daher häufen sich gerade im Bereich der Straßenverkehrsdeliktedie Fälle, in denen der Beschuldigte versucht, den Verdacht von sich (auf andere) abzulenken. Zur Beantwortung der Frage, ob die Grenze zu einer Straftat nach § 164 StGB bzw. dem formell subsidiären § 145d StGB bereits überschritten ist oder sich der Beschuldigte noch im Rahmen „strafloser Selbstbegünstigung“ bewegt, wird überwiegend auf eine Differenzierung nach Fallgruppenzurückgegriffen:
–Schlichtes Bestreiten:
Keine Straftat. 36
–Bezichtigung einer bislang unverdächtigen Person:
Falsche Verdächtigung. 37
–Bezichtigung einer tatsituativ verdächtigen Person:
Nach vorherrschender obergerichtlicher Rechtsprechung nicht strafbewehrt, da die Person auch durch das bloße Leugnen in den Verdacht der Ermittlungsbehörden geraten wäre. 38Abweichendes gilt jedoch dann, wenn der Beschuldigte weitere, den anderen belastende Umstände vorträgt oder die Beweislage verfälscht. 39
–Angabe falscher Personalien:
Grundsätzlich falsche Verdächtigung. 40Die Absicht im Sinne des § 164 StGB kann aber fehlen, wenn der Beschuldigte von faktischen Verfahrenshindernissen ausgeht – also etwa weiß, dass der Namensträger ohne festen Wohnsitz ist 41– oder wenn sich der Beschuldigte unter falschem Namen verfolgen lassen will. 42
–Bezichtigung des Belastungszeugen mit einer Falschaussage durch Bestreiten:
Aufgrund der Alltäglichkeit von „Aussage gegen Aussage“-Situationen, der rechtsstaatlichen Bedeutung des nemo-tenetur-Prinzips und der bekannten Unzuverlässigkeit von Zeugenangaben wird sich aus der Einlassung des Beschuldigten nicht nur die objektive Unrichtigkeit der Zeugenbekundungen, sondern darüber hinaus ein zumindest bedingter Vorsatz (§§ 153, 154 StGB) oder Fahrlässigkeit (§ 161 StGB) ableiten lassen müssen, um das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 164 StGB anzunehmen. 43
–Aufrechterhaltung/Wiederholung der Verdächtigung:
Keine Eignung, behördliches Verfahren herbeizuführen oder fortdauern zu lassen, es sei denn, die Unterbreitung neuer Tatsachen führt zu einer Verdichtung des Tatverdachts. Nach anderer Auffassung liegt eine Tat im Rechtssinne vor, bei Wiederholung der Verdächtigung vor einer anderen Stelle dürfte dann Tatmehrheit anzunehmen sein. 44
–Bezichtigung eines Unbekannten:
Umstritten, ob eine Beteiligtentäuschung im Sinne des § 145d Abs. 2 Nr. 1 StGB vorliegt. 45Denkbar wäre auch eine Strafbarkeit nach § 145d Abs. 1 Nr. 1 StGB, sofern der Beschuldigte durch seine Einlassung den Verdacht hervorruft, dass eine weitere prozessuale Tat begangen worden sei (der Beschuldigte einer Verkehrsunfallflucht behauptet, das Fahrzeug sei vor einigen Tagen von einer unbekannten Person entwendet worden).
83 Für einen transparenteren Umgang mit Beschuldigtenlügenplädiert Krell 46 und will die Frage der Strafbarkeit an den betroffenen Interessen messen: Sofern ausschließlich staatliche Belange tangiert seien, soll die Straffreiheit der Beschuldigtenlüge aus der grundgesetzlich garantierten Selbstbelastungsfreiheit folgen. Bei Eingriffen in Rechtsgüter Dritter würden diese den Bereich der Grenzen der Legalität jedoch verlassen. Folge soll eine regelmäßige Strafbarkeit von wahrheitswidrigen Vorgaben des Beschuldigten sein, sofern sie unter § 164 StGB fallen, wohingegen sie bei § 145d StGB straffrei bleiben. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass die Selbstbegünstigung in § 145d StGB unter Strafe gestellt werde, während sie in anderem Zusammenhang – etwa bei Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB) oder Strafvereitelung (§ 258 StGB) – sanktionslos bleibe. Die angebliche überflüssige Arbeitsveranlassung sei nur scheinbar ein Argument für eine derartige unterschiedliche Behandlung selbstbegünstigenden aktiven Tuns. Entsprechende Konsequenz dieser von Krell vorgeschlagenen konsequente(re)n Abgrenzung von straffreiem und strafbewehrtem selbstentlastenden Handelnwäre etwa, dass die rechtfertigende Einwilligung des zu Unrecht Verdächtigten die Strafbarkeit nach § 164 StGB entfallen ließe, da dann – der Tatbestand schützt nach herrschender Meinung sowohl private als auch staatliche Interessen – nur noch die zuletzt genannten betroffen wären. Ferner wäre § 145d StGB aufzuheben. Insgesamt ist eine Lösung de lege ferenda wünschenswert.
1.7.2Guter oder schlechter Leumund
84 Ein beliebter und nicht auszurottender Irrglaube dokumentiert sich in einem alten Sprichwort: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“. Dies ist eine Fehleinschätzung, die auf der Grundlage beruht, dass sich die Glaubwürdigkeit einer Person und die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage über die Persönlichkeit, den Lebenswandel und das Vorverhalten erschließt.
Читать дальше