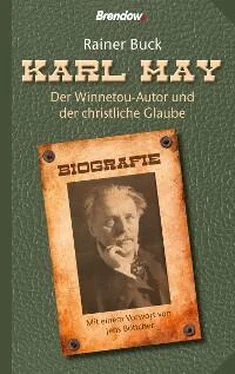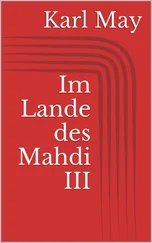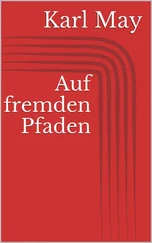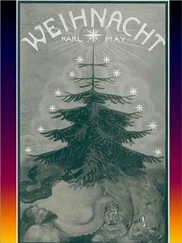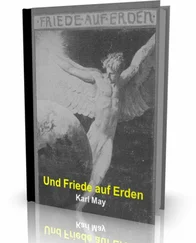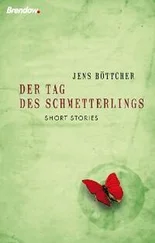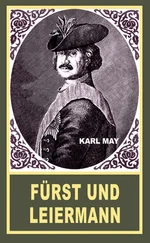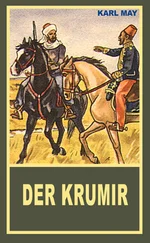Ich wage deshalb mal die Behauptung, dass man diesen inneren Konflikt, all die Seelenbewegungen des Schriftstellers May als Leser seiner Werke erspüren kann, auch wenn die Faszination des Guten und Reinen in seinem Schaffen natürlich überwiegt. Wenn es nun aber stimmt, dass besonders jene Menschen, die selbst mit der Dunkelheit vertraut sind, die Gabe besitzen, uns nachhaltig vom Licht zu künden, dann ist May ein ganz hervorragendes Beispiel für einen, der von höherer Stelle nie von den beiden Quellen der Inspiration getrennt wurde, weder von der himmlischen noch von der irdischen. Und somit ist und bleibt er, unterschwellig gefühlt, immer einer von uns: ein Sprachrohr der vielen Suchenden, die schon in der Verkündigung spüren, dass das Sprachrohr selbst nicht vom Menschsein »geheilt« ist, nur weil es uns das Ideal so wunderbar zu beschreiben weiß. Der zeitgenössische Schriftsteller Phillip Yancey, der eine Reihe von erfolgreichen Lebenshilfebüchern veröffentlich hat, sagte diesbezüglich einmal über sich selbst, er sei ein »professioneller Schizophrener«. Und meinte damit sinngemäß, dass er anderen Menschen mit seinen Büchern helfen kann, weil er weiß, worüber er schreibt, ohne dabei notwendigerweise zu wissen, wie er seine schönen Erkenntnisse fruchtbringend auf sein eigenes Leben übertragen könnte. Ich schätze, so ein »professioneller Schizophrener« war Karl May auch.
*
Sie werden außerdem in diesem schönen Buch viele interessante Hintergrundgeschichten zu Mays persönlichem Glauben finden. Und zu seinen Irrwegen. Als einem Leser, der sich mit Mays Biografie bislang nur sehr oberflächlich beschäftigt hat, kamen mir einige davon wirklich ziemlich haarsträubend vor, dazu geradezu boulevardesk – heute würde er es damit sicher regelmäßig in die Sendung »RTL-Explosiv« schaffen. Es scheint wirklich erstmal schwer vorstellbar, dass dieser Vorzeigemoralist May offensichtlich kühn genug war, sich selbst immer wieder als Scharlatan und Gesetzesbrecher zu betätigen. Und was für wilde Stories gibt es da bitte schön! Die Episoden aus seinem frühen Leben etwa, in denen er sich auf fantasievollste Weise als Trickbetrüger versuchte, haben mich spontan an den Film »Catch me if you can« erinnert, in dem Leonardo di Caprio einen solchen Hochstapler spielt, dem es ziemlich glanzvoll gelingt, in die absurdesten Lebensrollen zu schlüpfen. Auch der junge Karl May hat diese tragikomischen Münchhausen-Geschichten in seinem eigenen Lebenstheater aufgeführt. Überdies erfand er dauernd irgendwelche neuen, abenteuerlichen Details seiner eigenen Biografie und behauptete lange Zeit öffentlich, er hätte die Abenteuer von Kara Ben Nemsi und Old Shatterhand auf seinen Reisen selbst erlebt (obwohl er diese Reisen natürlich nie angetreten hatte).
Noch zusätzlich verwirrend dabei eben: Mays christliches Gedankengebäude, immer wieder vermischt mit einer eher selbst geschnitzten Theologie, das schließlich alles zusammen in den großen Suppentopf der eigenen Fantasie geworfen und stets mit dem heiligen Ernst eines Missionars vorgetragen. Es ist wirklich faszinierend, das alles zu lesen. Zum Ende seines Lebens, als die Wahrheit mehr und mehr ans Licht kam, musste der große Schriftsteller eine Menge Schelte dafür einstecken. Aber ist das nun eigentlich wirklich verwerflich? Oder ist eine solche Scharlatanerie im Falle eines solchen Künstlers nicht eher grundsympathisch?
Mir persönlich kommt das alles ungemein spannend vor, eben echt und aufregend, ganz dem literarischen Werk des Künstlers entsprechend. Ich stelle es mir gerade vor: Die Grenzen von Realität und Fantasie verschwimmen, während der Schriftsteller und der Mensch May am Schreibtisch abwechselnd die Feder führen, die Worte formen sich auf Papier zu wunderbaren Geschichten, deren Held im Grunde immer eine fantastische und übertriebene Ausgabe des Verfassers selbst ist. So etwas ist womöglich schlimm, wenn einer Automechaniker ist und Chirurgen ausbildet oder wenn ein Hafenarbeiter sich irgendwann selbst für ein Schiff hält. Wenn man sich vor Augen hält, was für ein gewaltiges Werk bei Karl May daraus entstanden ist, erscheint es doch eher grandios und stimmig. May ist in all seinen schöngeistigen Fantastereien wohl eher lebendige Herausforderung, den Menschen, also in ihm auch uns, als Ganzes und Widersprüchliches zu betrachten. Seine Fantasie gab ihm eine überhöhte Wahrheit ein, die er zwar selbst nicht wirklich leben konnte, mit der er dann aber gleichzeitig unendlich vieles über den Menschen, der er war, und darüber hinaus den Menschen an sich, verriet. Und – das ist ja das Beste daran – mit der er unzählige Menschen glücklich machte. Ein professioneller Schizophrener eben. Und vielleicht gerade deshalb ein so hervorragender Geschichtenerzähler.
*
In all dem war May eben auch dieser feurige Gläubige, der sich selbst mehr und mehr als Missionar sah und dabei zunächst einen Weg gegangen war, den viele von uns ebenfalls aus eigener Erfahrung kennen: Aus der persönlichen Enttäuschung der eigenen Lebensumstände entfaltet sich die Hinwendung zu Gott. Es folgt das zähe Hadern mit den Dogmen und gerade mit jenen Menschen, die sich am eindrucksvollsten als Gottes irdische Stellvertreter ausgeben. Dazu die kontinuierliche Suche nach Vollkommenheit (wahrscheinlich eine Künstlerkrankheit), der Versuch, sich weiterzuentwickeln, es zu schaffen, sich unterwegs zu krönen mit der Wahrheit, an einem Erkenntnisstand anzukommen, der uns verstehen und wissen lässt, wie »alles funktioniert«, nach welcher kosmischen Uhr jede Form von Leben tickt. Dann irgendwann die Ohnmacht, dass Gott, wie man »ihn« auch dreht und wendet, eben doch nicht als Ganzes verstanden werden kann, schließlich die Demut, das Sich-selbst-Ausliefern und Herunterbrechen auf das Einzige, das man als Mensch als göttliche Essenz wirklich spüren oder zumindest ahnen kann. Die Liebe. Die Vergebung. Die Gnade, die gerade jene Gläubigen verstehen, die wissen, wie es sich anfühlt, schuldig zu sein.
Vielleicht muss man bei diesen Gedankenspielen obendrein noch Folgendes berücksichtigen: Karl May war ja überzeugter Christ. Aber er hatte auch eine tiefe Seele, die eines Künstlers obendrein. Diese Kombination ist nicht selbstverständlich. Und sie ist sogar gefährlich. Für den Künstler, der auch Christ ist, ist es oft sehr viel schwieriger, irgendwo (buchstäblich) einen Fuß auf die Erde zu bekommen, als für einen Christen, der auch Künstler ist. Letztere haben es nämlich relativ leicht. Sie werden zwar von der Welt außerhalb des frommen Lagers meist ignoriert, dafür aber automatisch von den anderen Christen akzeptiert – wenn sie Glück und eine anständige Presseabteilung hinter sich haben, sogar geliebt. Die Künstler, die auch Christen sind wiederum, haben oft ein echtes Problem: Vielen dogmatischen Christen sind sie nicht christlich genug, da sie sich eine oft unstillbare Neugier aufs Weltliche bewahren, während sie dem Rest der Welt aufgrund ihres offen zur Schau getragenen Glaubens suspekt sind oder im schlimmsten Falle gar vollkommen irre erscheinen. Ein Künstler also, der Christ ist, dessen Herz aber für die Kunst ebenso wie für die Tiefen und Leiden der menschlichen Seele brennt, befindet sich zeitlebens an einem sehr merkwürdigen inneren Ort. Er gehört überall hin und kann nichts dagegen tun, jedenfalls nicht, ohne das Gefühl zu haben, sich, seine Sehnsucht, seine Liebe oder die Kunst zu verraten. Gleichzeitig gehört er eben nirgendwo hin. Das ist ein Zustand, den ganz sicher nicht jede sensible Seele aushalten würde. Die Flucht vor dem Dogma und kleinkarierter Engstirnigkeit verführt schließlich zur Zucht eines eigenen Neurosengartens, der sich schnell zu einem persönlichen Dogma auswuchert. Wenn man nun bedenkt, dass, wie im Falle Karl May, dieser Zustand der inneren Heimatlosigkeit sich zu einem wirklich dramatischen psychischen Konflikt ausweiten kann, zu einem möglicherweise unlösbaren, lebenslangen inneren Drama, an dem sowohl geschäftliches als auch seelisches Wohlergehen hängen, kann man vielleicht auch besser nachvollziehen, warum May so viele Kontroversen ausgelöst hat und zum Ende seines Lebens so viele Prozesse und Gerichtsverhandlungen über sich ergehen lassen musste. Und warum überhaupt er immer wieder in so furchtbar viele Fettnäpfe getreten hat, die auf den ersten Blick für uns externe Moralapostel nicht wirklich nachfühlbar sind, weil sie nicht vereinbar mit seinem Werk und erst recht nicht mit seinem Glauben scheinen. Im Licht dieses Erspürens von Mays teilweise dramatischen Seelenbewegungen wirken für mich auch viele von seinen »Irrwegen« deutlich nachvollziehbarer. Ebenso die in seinem Fall erfolgreiche Flucht nach vorn ins Ideal, in die Offensive der Verkündigung.
Читать дальше