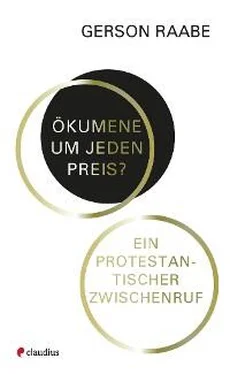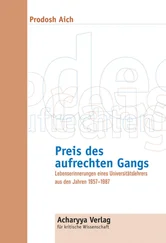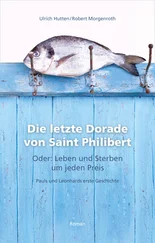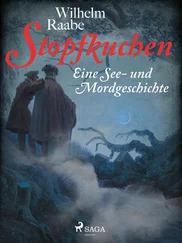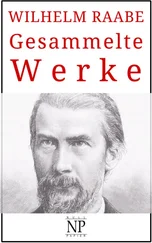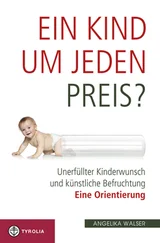Hinzu kommt, dass sich die Moderne, in der wir nach der Aufklärung leben, auch dadurch auszeichnet, dass die einzelnen Bereiche der gesellschaftlichen Wirklichkeit eigenständig geworden sind. Sie funktionieren sozusagen nach ihrer jeweils eigenen Logik. So darf für den Teilbereich der Wirtschaft etwa vermutet werden, dass Vorstände von Banken sich über die Allmachtsphantasien nur wundern konnten, die so manche kirchliche Verlautbarung etwa zur Diskussion um den Grexit deutlich werden ließ. Hier muss die Devise lauten: „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“
Auch sind Geschichten aus der Religion jedenfalls nicht geeignet, Probleme etwa der nordamerikanischen Steuerpolitik zu lösen. Aber ausgerechnet dort können Fundamentalisten ausgemacht werden, die in besonderer Weise in der Gefahr stehen, hier Grenzen zu verwischen. Gerade sie sind häufig der Meinung, die Bibel enthalte direkte Handlungsanweisungen, die unmittelbar in politische Münze übersetzt werden können. Von solchen Fundamentalismen sind die konfessionellen Großkirchen – Gott sei Dank! – (in der Regel jedenfalls) weit entfernt.
Zu Recht gilt jenen Fundamentalismen unsere Kritik. Fruchtbringend bleibt demgegenüber nach wie vor die häufig mühsame Auseinandersetzung mit den in der Regel komplexen Problemlagen und den daraus generierten Diskussionsbeiträgen, die sich weniger in Direktiven ausdrücken, als sich mit der Entfaltung von Alternativen an die Diskussionspartner wenden. Leider – und auch das gehört zu den Ausgangsproblemen gegenwärtiger ökumenischer Praxis – beteiligen sich die Großkirchen selten an solcher Ausdifferenzierungsarbeit. Eine Ausleuchtung von Tiefenbezügen bestimmter Debattenlagen kann jedenfalls sachdienlicher und hilfreicher sein als simplifizierte Direktiven.
Die großen Konfessionskirchen haben also kein Wächteramt in unserer Gesellschaft, so gerne sie dies hier wie dort in Anspruch nehmen mögen, und zwar nicht nur, um bei jeder passenden und eben auch unpassenden Gelegenheit ihren ungefragten Kommentar abzugeben. Solche Kritik am leider immer wieder missbräuchlich ausgeübten, falsch verstandenen Wächteramt muss selbst allerdings auch Maß halten. Denn es darf natürlich nicht übersehen werden, dass sich die Konfessionskirchen in diesen Zusammenhängen in einem Dilemma befinden, das sie mit anderen gesellschaftlichen Akteuren teilen. Die Medialisierung unserer Gesellschaft fordert regelrecht eine Unkultur der kraftmeierischen Ansage. Sie fordert das eindeutige, richtungsweisende Votum.
Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und Sozialverbände sind deshalb geradezu dazu gezwungen, „klare Ansagen“ zu machen. Wer sich an solchen Direktiven nicht beteiligt, wie redundant und damit wie wenig sachlich und hilfreich diese auch immer sein mögen, begibt sich in die Gefahr, sich aus dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu verabschieden und so unkenntlich zu werden. Trotz dieses Mechanismus kann mit einiger Mühe Maß, Ausgewogenheit und vor allem Angemessenheit sichergestellt werden. Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ausgewogenheit wird darauf zu achten sein, dass ein gebotenes Maß an Differenzierung eingehalten wird.
Kirche der Pluralität, Kirche der Meinungsvielfalt
Dass Kurzbeiträge zu den jeweiligen gesellschaftlichen Debatten durchaus hilfreich sein können, zeigen etwa die Weihnachtsansprachen des Bundespräsidenten oder das Wort der Bundeskanzlerin zum Neuen Jahr. Beiden gelingt es weit überwiegend über Partei- und Personengrenzen hinaus die Gefahren von Komplexitätsreduzierung und Populismus zu umgehen. Was in diesen Beiträgen zum gesamtgesellschaftlichen Diskurs anderen Akteuren zum Vorbild gereichen könnte, ist, dass sie es vermögen, gewissermaßen „mehrheitsfähig“ zu formulieren. Wohltuend ist hier die Vermeidung simplifizierender Direktiven und populistischer Vereinfachungen.
Gerade für die evangelische Kirche – in welcher der über das Modell des Priestertums aller Gläubigen gewonnene religiöse Gleichheitsgedanke gilt – ist eine Positionierung, die keine Einzelmeinung repräsentieren soll, natürlich besonders schwierig. Kein Bischof, kein Oberkirchenrat oder wer auch immer hat das Recht, „protestantische Positionen“ aufgrund seiner Stellung qua Amt zu legitimieren. Aufgrund des religiösen Gleichheitsgedankens gilt zudem, dass eine Position immer nur eine Position neben anderen – ebenso legitimen – Positionen ist. Was zählt, ist der sachliche Gehalt, nicht der hierarchische Ort, von dem aus ein Votum ergeht.
Damit gilt zumindest für den Protestantismus Pluralität als Grundmuster kirchlicher Wirklichkeit. Und damit ist – wie sich leicht zeigen lässt – natürlich ein Grundproblem hinsichtlich des Auftritts von Kirche in der Gesellschaft verbunden. Bezüglich eines strittigen Sachverhaltes kann es kirchlicherseits niemals nur ein Votum geben. Es gibt immer ein Bündel von sachlich hinreichend begründeten Standpunkten, die sich mitunter durchaus widersprechen können.
Darin ist denn auch das Problem enthalten, dass mit einer eindeutigen Verlautbarung von kirchenleitender Seite stets legitime, inhaltlich anderslautende Standpunkte verunglimpft werden. Diese gelten dann interessanterweise plötzlich als einzelne „Privatmeinungen“. Aufgabe kirchenleitenden Handelns wäre es also, auf diesen „Chor“ an Überzeugungen hinzuweisen bzw. ihn zum Klingen zu bringen. Der Vorzug solchen Handelns bestünde auch darin, deutlich werden zu lassen, dass die Meinungsvielfalt innerhalb des Protestantismus die Meinungsvielfalt der gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit spiegelt.
Nebenbei bemerkt liegt außerdem auf der Hand, dass gerade bei evangelischen kirchenleitenden Vertreterinnen und Vertretern in diesem Zusammenhang aus dem Unterschied zur katholischen Schwesterkirche, die den religiösen Gleichheitsgedanken so nicht kennt, Neidgefühle erwachsen können. Wir sind darauf bereits zu sprechen gekommen. Natürlich ist die Durchsetzungsfähigkeit in einem strikt hierarchischen System – um nicht zu sagen: in einem strikt autoritär verfassten System – um vieles größer als in einer Institution, deren Grundstruktur Pluralität ist.
Ökumene als Komplexitätsreduzierung?
Mit dem bisher Entfalteten ist noch ein Problem verwoben, das eine eigenständige Würdigung verdient: das Problem der Eindeutigkeit. Direktiven bringen die Gefahr mit sich, dass der Eindruck entsteht, die Dinge wären eigentlich ganz einfach, sozusagen schwarz-weiß. Dass dem in den allermeisten Fällen nicht so ist, haben wir bereits angesprochen. Um diese Eindeutigkeit einleuchtend darzulegen, wird in vielen Fällen tatsächlich vorhandene Vielschichtigkeit reduziert. Wir können auch sagen, dass die Dinge in der Regel komplex sind. Jede kernige Direktive verlangt daher nach einer Reduzierung von Komplexität.
Für unsere gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit können wir diesen Zusammenhang auch aus anderer Perspektive plausibilisieren: Das Leben an sich ist unter den Bedingungen der Moderne kompliziert geworden. Wir können auch von einer Unübersichtlichkeit des Lebens sprechen. Solche Unübersichtlichkeit sehnt sich – wie wir gerade angesprochen haben – nach Eindeutigkeit. Vermutlich liegt in dieser Sehnsucht auch ein Grund für die großen Erfolge, die die unterschiedlichen Populismen gegenwärtig haben.
Und obwohl solche Populismen eine Versuchung für kirchliches Auftreten in unserer Zeit enthalten könnten, wären die Kirchen sicherlich gut beraten, sich solcher Vereinfachungen nicht zu bedienen. Solche Vorsicht walten zu lassen, gilt auch angesichts des kirchlichen Hinweises, dass Verlautbarungen immer in ihrem Kontext, etwa einer Predigt, verstanden werden müssen. Und natürlich ist einzuräumen, dass hier auch Missbrauch möglich ist, ob versehentlich oder mit Absicht. Immer wieder besteht die Gefahr, dass Einzelnes aus dem Zusammenhang gerissen und dann in seinem Gehalt verzerrt oder gar verfälscht wird. Unabhängig davon ist aber auch die angesprochene Ausgabe von Direktiven kritisch wahrzunehmen.
Читать дальше