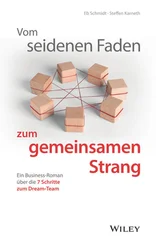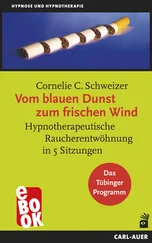Unter der Prämisse, dass die Aufgabenstellung in den Abiturarbeiten vor Einführung des Zentralabiturs von den Fachlehrern entsprechend ihren jeweiligen Unterrichtsschwerpunkten auf ihre Schüler zugeschnitten wurde, ist unbestritten, dass vom Schüler ein Basiswissen einzubringen war, dessen fachliche Qualität in der Darstellung ein entscheidendes Beurteilungskriterium darstellte. Auch waren hier die höherwertigen Anforderungsbereiche wie Bewertungen, Deutungen und Kritik nur auf der Grundlage von Fachwissen möglich. Dies galt grundsätzlich für alle Bundesländer. Die Problematik solcher Aufgabenstellungen ist dann auch eine andere. Nicht die Themenbereiche sind falsch gewählt, vielmehr ist das umfangreiche Arbeitsmaterial mit den darin enthaltenen Lösungen der eigentliche Kritikpunkt. Selbst die vorliegende Aufgabe zur Populationsökologie beispielsweise der Streifenhörnchen bekäme einen anderen Anspruch, wenn das Arbeitsmaterial lediglich die Grafiken mit den Aufgabenstellungen ohne zusätzliches Informationsmaterial enthielte.
Die Aufgabenformate leiten sich aus den bekannten, in der alten Lernzieldebatte der siebziger Jahre entwickelten Anforderungsbereichen ab, wie der Reproduktion (»Beschreiben Sie zusammenfassend …«), des Transfers (»Vergleichen Sie … ») und der Kritik (»Analysieren Sie …«, »Erklären Sie …«). Hinzu treten nun die mit den Bildungsstandards geforderten höheren Fähigkeiten des eigenständigen »Entwickelns von Arbeitshypothesen zur Erkenntnisgewinnung, der darstellenden Kommunikation und der praktischen Bewertung«. Damit wird – nimmt man das wörtlich – ein hoher Anspruch an die Schüler formuliert. Schon das vermeintlich Einfache einer beschreibenden Zusammenfassung stellt eine beträchtliche Leistung dar, geht es doch um die Verdichtung eines Textes, die das Wesentliche bewahrt und es mit eigenen Worten ausdrückt. Erst recht ist das bei allen wirklich analytischen Tätigkeiten der Fall. Der Schüler soll erklären, was die Wissenschaft als Erkenntnis anbietet. Das geht nicht ohne das Verstehen der Sache. Dieser Anspruch wird dem Anschein nach mit den Bildungsstandards noch weiter gesteigert. Wenn Schüler solche Kompetenzen nachweisen sollen, müssten die Aufgabenformate dazu angetan sein, ihnen auch die selbständige Entwicklung von Hypothesen abzuverlangen. Die konkrete Aufgabenstellung sowie deren Rahmung und Füllung mit dem beiliegenden Material zeigen aber, dass keine Rede davon sein kann, dass die Schüler solche Fähigkeiten tatsächlich nachzuweisen haben. Es soll in Wirklichkeit nichts erklärt und analysiert, sondern immer nur reproduziert werden, was bereits im Text des Aufgabenmaterials steht. Die Rhetorik der Aufgaben und das umfangreiche Arbeitsmaterial wirken dabei auf den ersten Blick höchst anspruchsvoll. Dahinter verbirgt sich das Gegenteil: die Reduktion der Aufgabe auf einfachste Informationsentnahme. Die Aufgabe fordert nicht ein, was sie vorstellt. Eine solche Form der Kompetenzorientierung springt als Tiger und landet als Bettvorleger.
Gibt es auch Zentralabiturarbeiten mit einem akzeptablen fachlichen Niveau? Wie neueste Analysen von Zentralabituraufgaben im Fach Biologie aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen, gibt es die tatsächlich. Mit Lesekompetenz ist dort kein Blumentopf zu gewinnen. Auf den ersten Blick sieht man, dass die Aufgaben bis zu 80 Prozent weniger Textmaterial enthalten, wie neuere Analysen eindeutig belegen.21 Außerdem sind die themenbereichsübergreifenden Aufgabenstellungen fachlich deutlich anspruchsvoller. 2012 beschäftigt sich die Aufgabenstellung auf erhöhtem Niveau in Mecklenburg-Vorpommern im Themenbereich »Biodiversität und Lebenserscheinungen im Meer« mit dem Thema »Ökologische Beziehungen und Stoffwechselaktivitäten bei Algen und Bakterien«.22 Schon allein vom Titel her ist dies ein anderes Kaliber als »See-Elefanten« oder »Rabenvogelstreit«. Solche Aufgabenstellungen mit Anteilen aus der Zell- und Stoffwechselbiologie sind nicht nur in NRW, Bremen und Hamburg strengstens untersagt. Nicht nur dort sind die Themenbereiche der Biologie meist auf drei Themen zusammengeschrumpft: Ökologie, Evolution und Genetik. Neurobiologie kam in Nordrhein-Westfalen in den letzten zehn Jahren nur zweimal vor. Bremen schießt den Vogel ab und verlangt in seinem Zentralabitur mit Ökologie und Genetik nur noch zwei Themengebiete von ursprünglich mindestens sechs. Hier liegen ganz offensichtlich Welten zwischen den jeweiligen fachlichen Anforderungen. Die grundlegenden Bereiche Zellbiologie und Stoffwechselbiologie sind in den meisten westlichen Bundesländern längst aus dem Kanon entfernt worden. Der Grund liegt auf der Hand: Ohne biochemische Kenntnisse sind diese Aufgaben nicht zu lösen. Das wiederum steht den angestrebten hohen Abiturientenquoten im Weg.
Betrachten wir nun die Aufgabe aus Mecklenburg-Vorpommern genauer. In der ersten Teilaufgabe muss der Schüler eine Pflanzenzelle zeichnen und mindestens sechs Zellbestandteile beschriften. Dazu erhält der Schüler kein Informationsmaterial. Entweder der Schüler kennt eine Pflanzenzelle und deren Bestandteile, oder er muss passen. Diese als Einstieg einzubringende Leistung entspricht dem korrekt angegebenen Anforderungsbereich I. In Teilaufgabe 2 wird vom Schüler eine Analyse einer Grafik verlangt, aus der ersichtlich ist, dass aufgrund der Sonneneinstrahlung und Temperaturerhöhung die Algenproduktion in den Sommermonaten höher ist. Er muss wissen oder aus dem Material schließen, dass Phosphate und Nitrate die dafür verantwortlichen Pflanzennährstoffe sind. Dies bekommt er keineswegs im Text vorgegeben. In Teilaufgabe 3 wird vom Schüler erwartet, dass er mindestens zwei ökologische Folgen benennt, die sich aus der Massenentwicklung von Algen ergeben. Informationsmaterial dazu, aus dem er die Antworten entnehmen könnte, gibt es wiederum keins. Teilaufgabe 4 hat nun allerhöchstes fachliches Niveau, und es ist mit einiger Sicherheit davon auszugehen, dass diese Frage in mindestens zehn von 15 Bundesländern von den dortigen Schülern nicht mehr beantwortet werden kann, weil derart grundlegende Fachinhalte aus dem Themenkanon sowohl der Qualifikationsstufe als auch aus dem Zentralabitur längst verbannt worden sind.
Der Schüler erhält im Material Experimente zum Ablauf der Photosynthese einer Algensuspension. Um die Aufgabe ohne irgendwelche Informationsvorgaben entsprechend dem Erwartungshorizont lösen zu können,23 muss der Schüler die biochemischen und molekularbiologischen Grundlagen der Photosynthese mit der Kopplung von lichtabhängigen und lichtunabhängigen Reaktionen komplett präsent und verstanden haben, ansonsten ist eine Anwendung auf die konkreten Versuche und deren Deutung nicht möglich. Hier sind zusätzlich prozessbezogene Kompetenzen auf der Basis von Fachinhalten zu erbringen.
Auch in Hessen gibt es den Themenbereich »Ökologie und Stoffwechselbiologie«, wodurch in jedem Fall ein anderes fachliches Niveau erreicht wird. Reine Populationsökologieaufgaben kommen auch dort nicht vor. Außerdem muss der Schüler zumindest in den ersten meist materialunabhängigen Teilfragen nachweisen, dass er fundierte Kenntnisse zum Thema als Wissensgrundlage mitbringt. Schaut man sich eine Aufgabe des Jahres 2015 aus diesem Bereich zum Thema »Stoffkreisläufe in mikrobiellen Matten« einmal näher an, lautet die erste Aufgabe: Beschreiben Sie den Ablauf der lichtabhängigen (nichtzyklischen) Reaktionen der Fotosynthese grüner Pflanzen . Das24 muss man wissen. Dazu gibt es kein Informationsmaterial. Da die weiteren Teilaufgaben sich weiterführend mit diesem Thema beschäftigen, ist der Nachweis von grundlegendem Fachwissen vonnöten. Auch der vom Schüler eingeforderte Vergleich mit den Stoffwechselvorgängen bei farblosen Schwefelbakterien weist fachlich ein hohes Anforderungsniveau auf und könnte niemals von Neuntklässlern bearbeitet werden.
Читать дальше