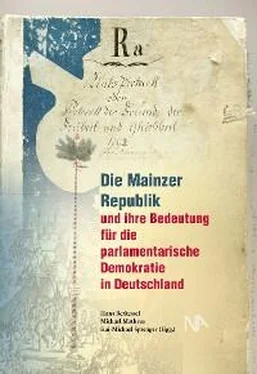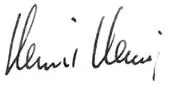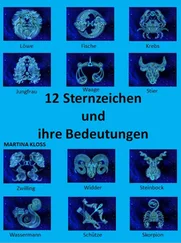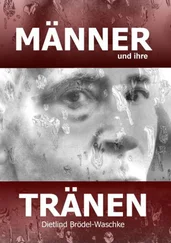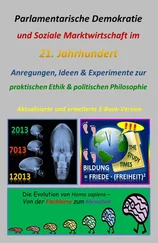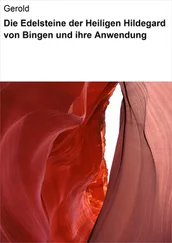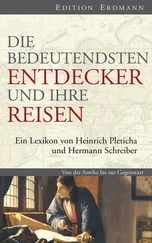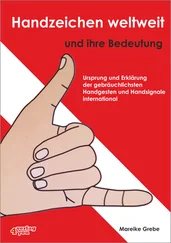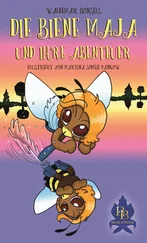Hans Berkessel Michael Matheus Kai-Michael Sprenger
HENDRIK HERING
Zum Geleit

Wer in Deutschland nach den frühen Gehversuchen der Demokratie sucht, der kommt am Sitz des Landtags Rheinland-Pfalz, dem historischen Deutschhaus, nicht vorbei. Hier debattierte der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent, das erste auf der Grundlage moderner demokratischer Grundsätze gewählte Parlament in Deutschland. Am 18. März 1793 rief es einen auf demokratischen Prinzipien – Freiheit, Gleichheit, Volkssouveränität – beruhenden Staat aus. Kein anderes Landesparlament in Deutschland tagt an einem vergleichbar geschichtsträchtigen Ort.
Die Ereignisse von damals markieren, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, „den Beginn des schwierigen deutschen Wegs zur parlamentarischen Demokratie. Es war, wie wir wissen, ein krummer und steiniger Weg, und das frühe demokratische Experiment in dieser Stadt steht in einzigartiger Weise für seine Widersprüche, Brüche und Rückschläge.“
Mit dem Hambacher Schloss liegt ein weiterer Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz. Trotzdem wissen wir auch heute noch mehr über die absolutistischen Fürsten als über die frühen Demokratiebewegungen in unserem Land. Wie die Wiederentdeckung der Bergzaberner Republik in jüngster Zeit zeigt, klafft auf der Landkarte der Demokratiegeschichte noch so mancher blinder Fleck.
Es ist das Verdienst von Institutionen wie dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, die historische Demokratieforschung beharrlich voranzutreiben und hier Abhilfe zu schaffen.
Ich bin der Überzeugung – wer weiß, unter welchen Mühen unsere Demokratie einst errungen werden musste, wird auch heute engagiert für sie eintreten. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen Fachtagung zum 225. Jahrestag der Mainzer Republik jetzt leserfreundlich und reich bebildert vorliegen.
Das Buch trägt den aktuellen Forschungsstand zusammen, dokumentiert die Festveranstaltung im Landtag und liefert wertvolle Hintergrundinformationen. Damit trägt es zu einem differenzierten, kritischen Gedenken bei und stärkt gleichzeitig die demokratische Tradition unseres Gemeinwesens.
Ich wünsche dem Buch eine breite Leserschaft.
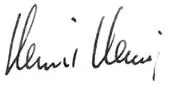
Hendrik Hering
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz
I. Beiträge
MICHAEL MATHEUS
Mainzer Republik – Französischer Revolutionsexport, deutscher Demokratieversuch, Mosaikstein einer europäischen Freiheitsgeschichte 1
V ier Jahre, nachdem die Mainzer Republik im Landtag von Rheinland-Pfalz anlässlich des 220. Jahrestages geschichts- und kulturpolitisch eingeordnet wurde, erinnerte 2017 eine Fachtagung erneut an diesen Mosaikstein unserer demokratischen Tradition. In vieler Hinsicht handelte es sich 2013 um einen bemerkenswerten Versuch einer weitgehend konsensualen Erinnerung und Aneignung, mitgetragen von den damals im Stadtrat und im Landtag vertretenen Parteien. Hierzu trug auch eine viel beachtete Rede von Bundestagspräsident Nobert Lammert bei. Schon am 18. März 2012 hatte er die Mitglieder der Bundesversammlung in Berlin auf das Mainzer Geschehen am 18. März 1793 hingewiesen. In seiner Rede betonte er im folgenden Jahr im Parlament des Landes Rheinland-Pfalz, die Mainzer Republik könne „ganz sicher nicht als (der) glanzvolle Beginn einer stabilen deutschen Demokratie“ gelten, sei aber „gewiss mehr als ein lokales oder regionales Ereignis.“ 2Ein während der Festveranstaltung des Jahres 2013 formuliertes Postulat liegt auch den folgenden Ausführungen als methodische Prämisse zugrunde. „Wir müssen der Versuchung widerstehen, unser heutiges Demokratieverständnis als Messlatte zu nehmen“ für Versuche in der Vergangenheit, „eine gewählte Volksvertretung an die Stelle einer als gottgegeben empfundenen Ständeordnung zu setzen.“ 3
Diese von bemerkenswerter Zustimmung getragene Aneignung war keineswegs selbstverständlich, wurde doch besonders in der Phase des sog. Kalten Krieges die wissenschaftliche und kulturpolitische Beschäftigung mit der Mainzer Republik in geradezu agonale Deutungen eingespannt. Im Rahmen dieses Bandes geht es um die wissenschaftliche Verortung der Mainzer Republik. Zwischen Jubiläen und Gedenktagen einerseits und historischer Forschung andererseits muss unterschieden werden, sollte Distanz bestehen. Nicht selten spiegeln Jubiläen mehr Befindlichkeiten der eigenen Gegenwart, als dass sie das historische Ereignis angemessen würdigen. Die Unabhängigkeit wissenschaftlicher Arbeit muss in jedem Fall gegenüber politischer Vereinnahmung bewahrt bleiben. Andererseits existiert keine unüberbrückbare Kluft, vielmehr können beide Pole in wechselseitigem, gelegentlich spannungsvollem, aber im besten Fall konstruktivem Austausch aufeinander angewiesen sein.
Am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2017, mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mainz mit Blick auf die Märzrevolution und die Weimarer Republik, „dass die Demokratie weder selbstverständlich noch mit Ewigkeitsgarantie ausgestattet ist. Dass sie – einmal errungen – auch wieder verloren gehen kann, wenn wir uns nicht um sie kümmern.“ 4Von der Mainzer Republik sprach er am 19. März 2018 bei seinem Besuch in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz am Ende seiner „besondere[n] Deutschlandreise“ zu Orten, „an denen mutige Männer und Frauen zu unterschiedlichen Zeiten für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gestritten haben.“ 5Die Mainzer Republik markiere „den Beginn des schwierigen deutschen Wegs zur parlamentarischen Demokratie. Es war, wie wir wissen, ein krummer und steiniger Weg, und das frühe demokratische Experiment in dieser Stadt steht in einzigartiger Weise für seine Widersprüche, Brüche und Rückschläge.“ Zugleich sprach er sich mit Blick auf die Ereignisse von 1792/93 für ein „differenziertes und kritisches Gedenken“ aus: „an die erste freiheitliche und demokratische Bewegung, die es auf deutschem Boden gab, aber auch an die Schattenseiten des Regimes, das die Mainzer Demokraten dann mit Hilfe der französischen Besatzungskräfte ins Leben riefen.“ Zum „ambivalenten Prolog“ (Frank-Walter Steinmeier) einer deutschen Demokratiegeschichte, die ohne ihre europäischen Zusammenhänge nicht verstanden werden kann, zählen aber auch ältere Gestaltungsversuche politischer Partizipation wie die antike Polis und die mittelalterlichen Bürgerkommunen. Diese sind zwar untergegangen, wirkten und wirken aber über Prozesse der Rezeption und nicht zuletzt der Instrumentalisierung und Stilisierung historischer Ereignisse weiter. In Mainz beendete der Einsatz von Militär sowohl die Geschichte der mittelalterlichen Stadtkommune als auch die der Mainzer Republik. Im Folgenden werden zunächst drei Aspekte aus dem Blickwinkel der longue durée und anschließend die Studien des Bandes angesprochen.
Demokratie- und Freiheitsdiskurse als Bestandteile der europäischen Geschichte
Begriffe, die zu den zentralen Bestandteilen unserer politischen Kultur zählen, reichen, wie der aus dem Griechischen stammende Begriff der Politik selbst, weit in die europäische Geschichte zurück. In zentralen Texten ihrer Erinnerungskultur von Solon, Kleisthenes, Perikles über Platon und Aristoteles, Thomas von Aquin, Marsilius von Padua und Wilhelm von Ockham bis zu Max Weber und Jürgen Habermas spielten und spielen sie eine Rolle. Der Begriff der Demokratie ist bekanntlich kein deutsches Wort, ihn verdanken wir der griechischen Sprache und Kultur. Noch heute erweist sich die Antike für Europa als unverzichtbarer Bezugspunkt, fasziniert die attische Demokratie mit ihrem Prinzip, Macht breit zu verteilen, ihrem hohen Grad an bürgerlicher Partizipation und einer enormen Wertschätzung rhetorischer Kompetenz. Damals galten Rede- und Überzeugungskunst als unverzichtbare Voraussetzung politischen Erfolgs und im Wettbewerb zu erringender Autorität. Die Polis der Athener gilt in Schulen und Universitäten zurecht als eine unverzichtbare Referenz bei der Erkundung demokratischer Herrschaftsformen. Sie kannte bei allen Differenzen zu modernen Demokratien sowohl direkte Elemente, in denen das Volk (der demos ) unmittelbar an Entscheidungen beteiligt war, als auch repräsentative Institutionen, in denen Vertreter anstelle des Volkes handelten und allgemein verbindliche Entscheidungen trafen. Dies gilt, obgleich in Athen Instrumente moderner Demokratien wie Parlament und Parteien unbekannt waren, und von einer Gleichheit aller Bewohner der Polis keine Rede sein kann. 6Auch an den Wahlen zum Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent 1793 konnten nicht alle teilnehmen. Frauen, Knechte und Mägde waren bei der Konstituierung dieses auf deutschem Boden erstmals nach allgemeinem Wahlrecht gewählten Parlaments nicht zugelassen. Alle selbständigen Männer ab 21 Jahren konnten ihre Stimme abgeben, freilich erst nach einer verordneten und gegebenenfalls erzwungenen Eidesleistung.
Читать дальше