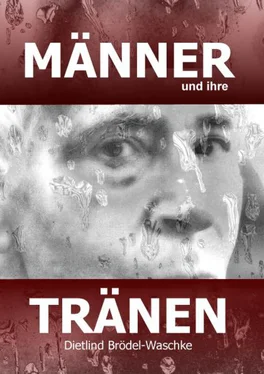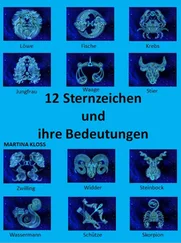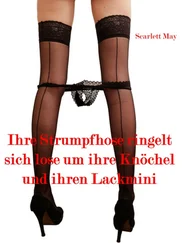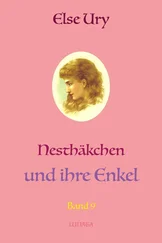Für die freundliche Unterstützung
herzlichen Dank an
oAutohaus Grundmeier – Harsewinkel
oGleichstellungsstelle der Stadt Harsewinkel
oKuBi – Harsewinkel
omedia and more GmbH – Gütersloh
oSparkasse Harsewinkel
oSpooren Architekten – Gütersloh
oWerkraum 8 GmbH – Gütersloh
oNeueMedienFraktion – Gütersloh

Männertränen
Dietlind Brödel-Waschke
Copyright 2011 Dietlind Brödel-Waschke
published by epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-0527-5
1. Auflage 2011
Fotografien:
Dietlind Brödel-Waschke
Dietlind Brödel-Waschke
Männer
und ihre
Tränen
© Marienfeld 2011
Für
Gerhard, Tjark und Felix
Männertränen und Gesellschaft –
Zulassungen und Unterdrückungen
Ein einleitender Beitrag von Prof. Dr. Matthias von Saldern
Herkunft und Bedeutung
Das Wort Weinen kommt aus dem Althochdeutschen weinon und bedeutet so etwas wie weh rufen.
Weinen ist ein unspezifischer emotionaler Ausdruck, der häufig der Mimik zugeordnet wird und der oft, aber nicht immer, mit Tränenfluss einhergeht. Weinen ist nicht an eine bestimmte Emotion gebunden, kommt aber beispielsweise häufig bei Schmerz, Trauer, Angst, Ärger, aber auch Freude vor. Derzeit geht man davon aus, dass der Mensch das einzige Lebewesen der Erde ist, das emotional bedingt weint.
Ursachen und Gründe
Ursachen sind wissenschaftliche Erklärungen, warum ein Mensch weint. Gründe hingegen sind die subjektiven Erläuterungen des einzelnen Menschen, warum er gerade weint.
Es existieren verschiedene Theorien, warum Menschen weinen, eine eindeutige Antwort konnte die Wissenschaft allerdings bis heute nicht liefern.
Einige Studien zum Weinen gehen davon aus, dass Weinen ein Sozialverhalten ist, das die Funktion hat, andere Mitglieder einer sozialen Gruppe auf ein Ereignis aufmerksam zu machen oder vor einer Gefahr zu warnen, da die Gefühlsreaktion des Weinens auch die Kenntnis eines Einzelnen von einem schwerwiegenden Ereignis ausdrücken kann und bis heute eine Art „Mitfühlreflex“ auslöst, der im Allgemeinen zur Folge hat, dass sie über die Ursachen dieser Reaktion bei einem einzelnen Mitglied der Gruppe in Kenntnis gesetzt werden.
Als archetypische Ausdrucksform wird das Weinen von allen Menschen verstanden, da es in Kombination mit der dazugehörigen Mimik (starke Freude oder ausgeprägte Trauer / Unsicherheit) den Beteiligten eine eindeutige Zuordnung des Verhaltens ermöglicht. Das Weinen kann auch Ausdruck ausgeprägter Freude sein, so zum Beispiel die „Freudentränen“, die als Reaktion von heftigem Lachen infolge von für den Betrachter außerordentlich lustigen Situationen zu verstehen sind. Bei manchen Menschen kann auch ein anhaltender, eindringlicher Blickkontakt Tränen auslösen.
Männer und Weinen
„Ein Junge weint nicht" war noch bis vor wenigen Jahrzehnten ein Standardsatz in der Jungen-Erziehung. Das traditionelle Männlichkeitsbild wurde von Goldberg (1986) wie folgt umrissen:
„Je weniger Schlaf ich benötige,
je mehr Schmerz ich ertragen kann,
je mehr Alkohol ich vertrage,
je weniger ich mich darum kümmern muss, was ich esse,
je weniger ich jemanden um Hilfe bitte und von jemandem abhängig bin,
je mehr ich meine Gefühle kontrolliere und unterdrücke,
je weniger ich auf meinen Körper achte,
desto männlicher bin ich.“
Tränen der Männer wurden lange Zeit unterdrückt. Einer der Gründe ist historisch-anthropologischer Natur: Das Weinen bei Männern in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte war gefährlich. Der Jäger, der bei der Jagd weint, wird jedes Wild vertreiben. Der Krieger konnte kaum mit Tränen in den Augen kämpfen. Daher ist auch der Begriff weinerlich bis heute negativ besetzt.
Weinen könnte seinen Ursprung in der menschlichen Entwicklungsgeschichte haben und eine Art Unterwerfungsgeste sein. Denn man sieht durch die Tränen nicht mehr so gut, wenn man weint. Man kann nicht mehr angreifen oder sich verteidigen.
Ein weiterer Grund ist, dass man Männern eine stärkere Emotionskontrolle zuweist. Gefühle, und damit Tränen, zu zeigen, war unschicklich. Als der niederländische Psychologe Ad Vingerhoets Frauen nach ihren Gefühlen während des Weinens befragte, konnten sie ihm oft zwei, drei, vier oder mehr gleichzeitig nennen. Frauen weinen (so Messmer, 2009) demnach am ehesten, wenn sie sich unzulänglich fühlen, vor schwer lösbaren Konflikten stehen oder sich an vergangene Zeiten erinnern. Männer hingegen weinen häufig aus Mitgefühl oder wenn die eigene Beziehung gescheitert ist. Dennoch bleibe emotionales Weinen insgesamt für die Wissenschaft rätselhaft.
„Eine Erziehung – ob römisch, britisch, preußisch oder wie auch immer –, die die Jungen zur Selbstbeherrschung anhält, verfolgt immer das Ziel, sie zur Herrschaft über andere zu befähigen. Wer weint, zeigt seine Ohnmacht, verliert nicht nur die Herrschaft über sich selbst, sondern ist auch zur Herrschaft über andere unfähig.“ (Kessler, 1994)
Geschichte der Männertränen
Der britische Historiker Bernard Capp hat eine Geschichte der Männertränen in England vorgelegt. Ihm zufolge hat sich in den letzten 400 Jahren wenig verändert: Von Situationen tiefer Trauer oder großer Katastrophen einmal abgesehen, dürfen Männer heute nur beim Fußball weinen.“
Ganz allgemein zeigte sich, dass Weinen als unmännlich galt. Es gab jedoch immer schon Ausnahmen, die eine Differenzierung zwischen den sozialen Schichten zeigt: Ein Gentleman mit guter Bildung durfte - gemäßigt - Tränen vergießen beim Tod eines oder einer teuren Angehörigen. Nur "einfachen" Männern wie etwa Bauern waren Tränen des Mitleids oder Bedauerns gestattet.
Schwerverbrecher, die zum Galgen geführt wurden, weinten häufig. Toleriert war dies aber für die Zeitgenossen nur, wenn dies als Zeichen religiöser Inbrunst gelesen werden konnte. Tränen aus Furcht waren für Männer verpönt.
Bis heute – so der britische Historiker – gibt es aber auch Bereiche, in denen Männer weinen dürfen. Dazu gehört vor allem der Fußball. Generell gilt aber immer noch, dass Männer (vor allem in der Öffentlichkeit) nicht weinen. Dies sieht man auch daran, wie intensiv vor allem über prominente Männer, die weinen, in den Medien berichtet wird.
Zahlen und Fakten
In einer Studie von Messmer (2006) wurden ein paar Zahlen und Fakten über den Unterschied zwischen Männern und Frauen deutlich. Männer weinen 6 - 17 Mal im Jahr, Frauen dagegen 30 - 64 Mal im Jahr. Dabei spielt durchaus das Alter eine Rolle: Bis zum 13. Lebensjahr weinen Jungen und Mädchen den Angaben zufolge noch ungefähr gleich häufig. Frauen sind beim Weinen ausdauernder: Sie lassen durchschnittlich etwa sechs Minuten lang die Tränen fließen, Männer dagegen bringen es maximal auf vier Minuten.
Auch beim Schluchzen unterscheiden sich die Geschlechter: Weinen geht nur bei 6 Prozent der Männer in Schluchzen über – und bei 65 Prozent der Frauen. Dadurch wirkt weibliches Weinen länger, dramatischer und herzzerreißender.
Es gibt Behauptungen darüber, dass man sich nach dem Weinen meist erleichtert fühlt. Dies scheint aber falsch zu sein: Messmers Untersuchung zeigt, dass das Weinen nicht im Sinne eines Katharsis-Effektes zu einer innerlichen Reinigung führt. Wenn dies zuträfe, müsste es den Menschen nach dem Heulen besser gehen. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Anlass für die Tränen weggefallen ist.
Dass Weinen körperlich entspannt, ist ebenfalls nicht haltbar: Beim Weinen sind nach Messmer Menschen körperlich erregt, und zwar von Anfang bis Ende. Viele merken dabei überhaupt keinen Unterschied und bei jedem Zehnten ist es so, dass sie sich nach dem Weinen sogar schlechter fühlen. Aber man hat auch herausgefunden, dass es einem meist besser geht, wenn man anschließend getröstet wird.
Читать дальше