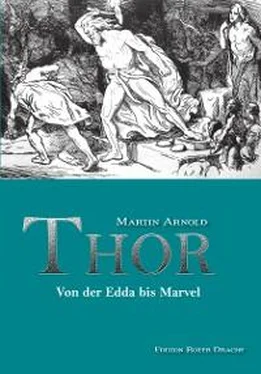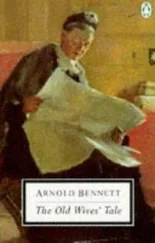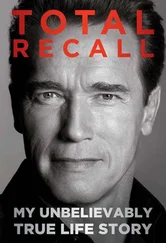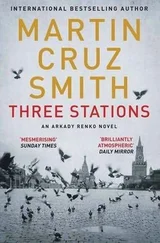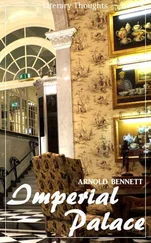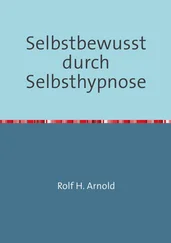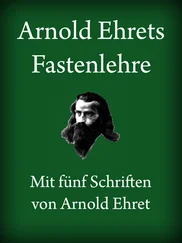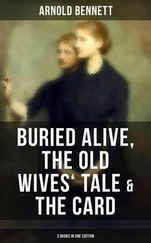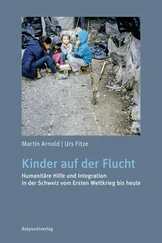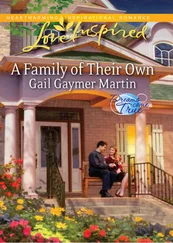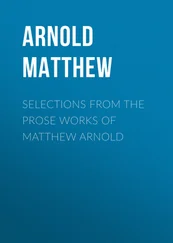Wenn auch natürlich die Gefährlichkeit der männlichen Riesen die Sicherheit aller Götter bedroht, so wird sie oft als eine besondere Gefahr für die Göttinnen betrachtet. In diesem Sinne sind die männlichen Riesen abscheuliche sexuelle Konkurrenten, eine „primitive, minderwertige Rasse“, die, sollte sie sich durchsetzen, das Blut der Götter auslöschen, ihre Fruchtbarkeit vermindern und dadurch schließlich ihre Autorität schwächen würde. Die Tatsache, dass dieses Tabu nicht auch umgekehrt gilt, ist charakteristisch für die männlichen Vorrechte und Rechtsansprüche, die ein Patriarchat definieren. Thor ist, mit all seiner Kraft, in vielerlei Hinsicht die Quintessenz dieser doppelten Moral. Ein zwingendes Beispiel für das, was man als Thors Frauenfeindlichkeit bezeichnen kann, zeigt sich, als der Gott den Versuch der Riesin Gjalp, ihn beim Durchschreiten des Flusses auf dem Weg zu Geirröds Halle in ihrem Urin und Menstruationsblut zu ertränken, vereitelt, indem er ihr einen großen Stein entgegenschleudert. Gemäß Thors Äußerung ‚Am Ausfluss soll der Strom sich stauen’2, zielte er mit dem Stein vermutlich auf ihre Fortpflanzungsorgane. Obwohl man dies auch als Thors notwendige Durchsetzung seiner Männlichkeit angesichts einer ‚ungezügelten weiblichen Sexualität’3 interpretieren kann, erweckt die Beschreibung weiblicher Macht, die von einem penetrierenden männlichen Akt überwältigt wird, den Eindruck von tief verwurzelten männlichen Ängsten gegenüber Frauen und von groben sexualisierten Reflexen, die diese Ängste häufig hervorrufen.4 Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht auch Thors Furcht vor allem, was seine Männlichkeit in Frage stellen könnte, wie etwa in der humoristischen ‚Þrymskviða’ (Thrymlied), in der er Frauenkleider anziehen muss und deshalb befürchtet, ‚die Asen werden mich einen Perversen nennen’; Perversität wird mit dem starken Begriff argr umschrieben , der auch Unmännlichkeit, Verweichlichung und Feigheit bedeutet.5
Trollfrauen und das Weibliche in altnordischen Mythen
Einige Riesen sind deutlich schlimmer als andere. Wiederholt ist davon die Rede, dass Thor unterwegs sei, um Trolle zu verprügeln oder zu töten – offenbar eine zentrale Rolle, die er zu spielen hat. Während die Riesin Hyrrokkin, die bei Baldurs Bestattung beinahe von Thor angegriffen wird, in mancherlei Weise an die Beschreibungen von Trollen in anderen Mythen und Legenden ähnelt, gibt es keine Mythen, die einzelne Begegnungen von Thor mit Trollen behandeln. Gleichwohl stellt sich – ungeachtet der Tatsache, dass die UnterscheIdunag zwischen den Begriffen ‚Troll’ und ‚Riese’ nicht immer ganz eindeutig ist – dort, wo in Lieder- und Prosa-Edda explizit von Trollen die Rede ist, heraus, dass diese stets weiblich sind.6 Was den Ursprung weiblicher Unholde im Allgemeinen betrifft, führt das ‚Hyndluljóð’ (Hyndlalied) an einer Stelle aus: ‚Schwanger ward Lopt [Loki] vom schlimmen Weib: auf die Erde kamen die Unholde so.’7 Lokis Mutterschaft wäre also für die Böswilligkeit der Trollfrauen ebenso verantwortlich wie Lokis Verbindung mit der Riesin Angrboda für das Unwesen der Midgardschlange, des Wolfes Fenrir und Hels. Eine Einsicht in die mythologische Aufgabe der Trollfrauen gewährt die ‚Völuspá (Der Seherin Gesicht), wo es heißt:
Eine Alte östlich im Erzwald saß;
Die Brut Fenrirs gebar sie dort.
Von ihnen allen wird einer dann
Des Taglichts Töter, trollgestaltet.8
Eine Erweiterung dessen liefert Snorri in der ‚Gylfaginning’:
Eine Riesin haust im Osten von Midgard in dem Wald, der Jarnwid genannt wird. Dort leben die Trollweiber mit dem Namen Jarnwidjur. Die alte Riesin gebiert viele Riesen als Söhne und alle in Wolfsgestalt. Von dort stammen diese Wölfe.9
Auch wenn die vollständige Bedeutung dieser Stelle nicht entschlüsselbar ist, scheint es so, dass von den Trollweibern jene Wolfsriesen abstammen, von denen einer die Sonne verschlingen wird (der Wolf Fenrir in der Ragnarök), und dass sie Geschöpfe der Wildnis sind. Falls, wie es nahe liegt, mit dem altnordischen Wort gífr , das sowohl den ‚Menschenfresser’ als auch die ‚Hexe’ bezeichnet, ebenso auch die ‚Trollfrau’ gemeint sein kann, folgt daraus offensichtlich, dass auch die Trollfrauen ihren Anteil an der Ragnarök haben – entsprechend der ‚Völuspá’, in der es heißt, dass ‚Riesinnen fallen, Felsen brechen’,10 wenn der Riese Surt, von apokalyptischen Feuern umlodert, auf Asgard vorrückt.
Aus der Anzahl der Riesen, die Snorri auflistet, kann man schließen, dass sie den Göttern zahlenmäßig überlegen sind und dass es mehr männliche Riesen als Riesinnen gibt. In Anbetracht dessen ist Thors Bestimmung, die Population der Riesen niedrig zu halten, erklärlich; und dies mag teilweise auch die Rivalität der Götter mit den männlichen Riesen bezüglich der Frauen beider Arten erklären. Gleichwohl kann – trotz des offenkundigen zahlenmäßigen Ungleichgewichts zwischen Göttern und Riesen – das Riesenland als eine geordnete und insgesamt im Gleichgewicht befindliche Gegenwelt zu Asgard begriffen werden, wobei die Feindseligkeiten jene zwischen zwei Stämmen spiegeln, die in permanentem Konkurrenzkampf um Land und Besitz zueinander stehen. Die Feindseligkeit der Trollfrauen hingegen folgt keiner so klar erkennbaren Motivation. Nie ist von materiellen Begehrlichkeiten ihrerseits die Rede, noch wird irgendein Grund für ihre Rachsucht angeführt, wie etwa in der Klage der Riesen gegen die Götter in der Erzählung vom Baumeister. In Anbetracht der dem Mythos zugrunde liegenden moralischen Werte ist die Feindschaft der Trollfrauen nichts weniger als reine Bosheit. Thor zögert natürlich nicht, Riesinnen zu tötet, die ihn bedrohen, wie es bei Geirröds Töchtern oder Thryms Schwester der Fall ist, doch was Trollfrauen betrifft, braucht er keine Rechtfertigung.
Diese, einem Völkermord gleichende Haltung einem kämpferischen weiblichen Stamm gegenüber weist auch hier auf ein tief sitzendes männliches Unbehagen hin, das in einem Gefühl bedrohter Autorität wurzelt. Einige Wissenschaftler haben sogar behauptet, der männliche Chauvinismus, der den Mythen innewohnt, sei zurückzuverfolgen zu einem früher existierenden Matriarchat, das an einem gewissen Punkt der Vorgeschichte von Männern usurpiert wurde. Im Nachhinein wurden dann Frauen, die Widerstand leisteten oder außerhalb männlicher Kontrolle standen, als Mannweiber mythologisiert. Frauen unterstanden grundsätzlich der patriarchalen Kontrolle, und es waren ihnen Beschränkungen auferlegt, insbesondere im Hinblick auf ihre Sexualität. Der oftmals geradezu dämonische Charakter von Seherinnen, deren geheimes Wissen und beunruhigende Vorausschau selbst die Weisheit Odins übertrifft, und die Herrschaft über das Schicksal, die den drei Nornen zugeschrieben wird, können eher als eine Unterstützung denn als eine Unterminierung dieser Behauptung betrachtet werden. Doch ist dies nicht viel mehr als Spekulation, da das Finden von Nachweisen für ein Prä-Patriarchat durch die Tatsache beschränkt wird, dass die Mythen, wie wir sie kennen, von Haus aus männliche Konstrukte sind.11
Thor zu verstehen, erfordert jedoch eine genauere Analyse dessen, was die Riesen dargestellt haben mögen; und diese weist über eine reaktionäre männliche Sexualität hinaus auf Fragen hinsichtlich der Sterblichkeit und der widersprüchlichen Weltbilder, die in der menschlichen Psyche angelegt sind. Eine Herangehensweise der strukturellen anthropologischen Theorie, besonders im Werk von Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009), besteht darin, die Riesen als Abstraktionen von Naturgewalten zu betrachten, die im Gegensatz zu den Kräften der Kultur stehen, die durch die Götter repräsentiert werden.12 Diese Zweiteilung ist in vielerlei Hinsicht überzeugend. Die Riesen leben draußen an der Peripherie, in der freien, ungebändigten Wildnis, wo zwangsläufig Gefahren lauern. Abgesehen von Utgardlokis Hof, leben alle Riesen, denen Thor begegnet, an einsamen Orten, während die Götter, ähnlich den Menschen, Gemeinschaften bilden. Um in die Anderswelt der Riesen zu gelangen, muss Thor Grenzflüsse überqueren, d. h. einen Übergangsritus an der Schwelle von einer Ebene der Existenz zur nächsten vollziehen: von der nährenden Sicherheit der Mitwelt zu den isolierenden Gefahren wilder, friedloser Orte. In stark vereinfachter Form ist dies ein Gegensatz zwischen Leben und Tod. Doch Menschen sind sowohl Natur- als auch Kulturwesen, und darin besteht eine der Paradoxien unserer Existenz. Auf der einen Seite sind Menschen auch voll wilder Triebe und schäumen vor antisozialen Antrieben, die einer Zügelung bedürfen, über; auf der anderen Seite hängt das menschliche Überleben vom Zusammenwirken und dem gemeinschaftlichen Nutzen ab. Und letztlich muss natürlich jedes menschliche Wesen seiner persönlichen Ragnarök begegnen – dem Punkt, an dem Natur und Kultur einander gleichsam aufheben. Wie die Götter haben auch menschliche Wesen Riesenblut in ihren Adern, weshalb ihre Endlichkeit vorherbestimmt ist.
Читать дальше