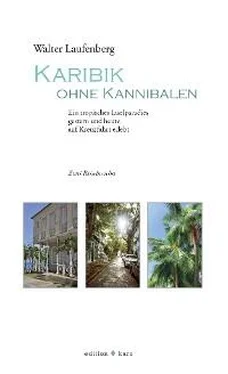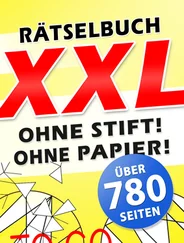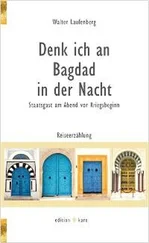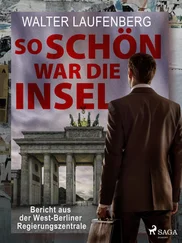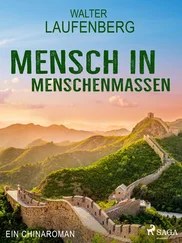Am frühen Nachmittag im Hafenviertel von Kingston angekommen und mit einem Aufatmen aus dem Wagen gekrochen, wurde jedem mit einem Blick klar, welchen Zweck die wilde Jagd hatte. Alle Busse und Taxis spuckten ihre Touristen vor einer riesigen Halle aus. Und diese Halle war vollgepackt mit Souvenirs. Ein Stand neben dem anderen, immer das Gleiche: Korbarbeiten, Holzgeschnitztes, Postkarten, Ketten, Hüte, Armreifen, Rumbakugeln und Trommeln. In jeder Koje saß eine dicke Mami und versuchte sich in Überredungskünsten. Weil das Schiff noch nicht im Hafen angekommen war, mussten die Durchgerüttelten fast vier Stunden lang den Kopf schütteln oder Dollars hinblättern. Kaum eine Möglichkeit, sich diesem Superangebot zu entziehen. Die Stadt Kingston lag weit weg, mit dem Taxi wäre das ein Aufwand von umgerechnet 25 Mark hin und 25 Mark zurück gewesen. Verzichtet. Aber außer dieser großen Halle, dem Crafts Market, gab es dort am Hafen nichts. Bloß noch die schäbige kleine Kneipe mit dem einsamen Goldfisch in seinem schiefhängenden Glaskasten, halb verdeckt hinter einem riesigen Ventilator in der Ecke.
Ich hätte vor Vergnügen trommeln können. Hatte ich doch eine kleine Bambustrommel an der Hand hängen. Der Tribut, den ich beim Warten auf unser Schiff gezahlt hatte. Ein langer Schwarzer war mir schon in der Halle mehrmals begegnet. Und jedes Mal hatte er mir etwas von seinen Waren verkaufen wollen. Dass ich keine der Halsketten aus Obstkernen brauchte, die er bündelweise um den Hals hängen hatte, sah er schnell ein. Aber die kleine Trommel, mit der er auf sich aufmerksam machte, schien ihm so recht für mich gemacht. Ich konnte noch so oft und wortreich gestehen, dass ich nicht trommeln könne und wolle, alles vergebens. Der Mann war auch überfordert mit meinen Hinweisen auf den modernen Wohnungsbau mit seinen dünnen Wänden und nervösen Nachbarn. Es gelang mir, den Mann immer wieder stehen zu lassen und mich in einen anderen Menschenklumpen hinein zu verdrücken. Aber dann, draußen auf dem Weg zu der Kaschemme, ging er wieder an meiner Seite. Und trommelte. Wie ein guter Kamerad, im Gleichschritt mit mir. Da habe ich ihm die Trommel abgekauft, um endlich meine Ruhe zu haben. Er strahlte und erklärte mich zu seinem Freund. Und mir schien, er hat ohne jede Erläuterung verstanden, wieso ich etwas kaufte, wofür ich keine Verwendung hatte. So selbstverständlich und stolz nahm er die Dollarscheine entgegen, offensichtlich als Anerkennung für ihn und für die rund 90 Prozent der Bevölkerung Jamaikas. Fast alle wie er Abkömmlinge der afrikanischen Negersklaven. Abkömmlinge auch der weißen Herrscher, denn die spanischen und britischen Herren haben mit ihrer Zuneigung zu den schwarzen Sklavinnen so nebenbei für eine vielfältige Blutsmischung gesorgt, ganz abgesehen von den Beimischungen, die auf das Konto eingewanderter Nordamerikaner und Chinesen und Inder gehen.
Auf dem Weg zu unserem Schiff, das endlich angekommen war und das Fallreep heruntergelassen hatte, konnte ich meine Trommel einem kleinen schwarzen Jungen schenken, der mitlief. Diese glücklichen Augen. Hoffentlich war das für ihn der Start zu einer blendenden Karriere als Jazzmusiker.
An dem Abend musste ich mich in einer der beiden Bordbibliotheken, die in getrennten Räumen waren, weiter mit den Schwarzen beschäftigen. Ich brauchte unbedingt die Information, dass im Jahre 1834 auf Jamaika die Sklaverei offiziell beendet wurde – und vier Jahre später tatsächlich. Den Hinweis fand ich in der Deutschen Bibliothek. Da konnte ich aufatmen. Ich las: Viele der befreiten Sklaven verließen die Plantagen und zogen sich in die Berge zurück. So mancher Zuckerrohr- und Kaffeepflanzer ging damals pleite, weil er keine Arbeitskräfte mehr hatte. Doch hat sich in der Folgezeit gezeigt, dass es auch ohne Sklaverei ging, nämlich mit Kontraktarbeitern. Jamaika wurde zum Großexporteur für Bananen, Zucker und Rum. Nicht zu vergessen Bauxit, das rote Gold Jamaikas, das bei der Herstellung von Aluminium unverzichtbar ist.
Jamaika war mehr als 300 Jahre britische Kolonie, ehe es im Jahre 1962 seine Selbständigkeit erhielt. Also erst vor neun Jahren, staunte ich. Ein Land, das die westafrikanische und spanische Kultur mit der britischen vermischte. Aus vielen Völkern erwuchs ein Volk, so wenig ursprünglich zu dieser Insel gehörend wie die meisten Pflanzen, die wir heute bestaunen können. Das Zuckerrohr brachten die Spanier auf die Insel. Der Kakao stammt aus Zentralamerika. Aus der Südsee holten die Engländer die Kokosnuss, die Banane und den Brotfruchtbaum. Aus Indien kamen Ingwer und Zitronen.
Und auch Kaffee und Tabak waren Fremdlinge auf dieser Insel. Nur der Jamaikapfeffer war schon vor den Eroberern hier. »Dahin, wo der Pfeffer wächst«, so heißt bei uns zuhause eine Verwünschung. Wenn die daheim wüssten, dass es hier traumhaft schöne Strände gibt, mehr als zweitausend Meter hohe Berge und über zweihundert verschiedene Orchideenarten …
Die vierte Reise des Kolumbus nach Westindien war die abenteuerlichste. Mit vier Karavellen und 150 Leuten war er vom 11. Mai 1502 bis zum 7. November 1504 unterwegs. Sein Brief an die Katholischen Könige, den er im Juli 1503 in Jamaika geschrieben hat, zeigt, dass dieses karibische Paradies auch die Hölle sein kann:
»Achtundachtzig Tage hindurch hatte der schreckliche Sturm nicht von mir gelassen, man sah keine Sonne und keine Sterne auf dem Meer. Die Schiffe leckten, die Segel zerrissen, die Anker und Winden gingen verloren, dazu Taue und viel Proviant; die Mannschaft krankte, alle waren zerknirscht, viele taten ein Gelübde, später ins Kloster zu gehen; keiner war, der nicht Opfer zu bringen und Wallfahrten zu machen gelobt hätte. Viele Male hatten sie gegenseitig ihre Sünden gebeichtet. Viele Stürme hat man gesehen, aber keinen, der so lange währte und solche Schrecknis brachte.«
Am Mittag im Hafen von Willemstad auf Curaçao, der größten Insel der Niederländischen Antillen. Die Stadt umarmte uns mit einer lähmenden Hitze. Kein Wunder, dass die meisten Passagiere zunächst in ihren Kabinen blieben, vermutlich mit voll aufgedrehten Klimaanlagen.
Willemstad war für mich ein schönes Beispiel dafür, wie es dazu kommt, dass die Touristen bei einem Landausflug nichts Wesentliches zu sehen kriegen. Der Hafen war bloß eine halbe Stunde Fußweg vom Stadtzentrum entfernt. Doch wo die Passagiere von Bord gehen durften, mitten zwischen riesigen Öltanks, Lagerhäusern und Schuppen, da standen nur zwei Schritte von der Gangway entfernt die schwarzen Taxifahrer neben ihren amerikanischen Chromkutschen und schrien die verschreckten Ankömmlinge an. Die kamen gar nicht dazu, festen Boden unten den Füßen zu spüren nach der erlebten Seestärke 5 der Anreise. Schon saßen sie in den Taxis oder im großen Bus und sausten davon. Schnell durch die malerischen Vorstadtgassen hindurch zur Hauptgeschäftsstraße entführt. Drei US-Dollar das Taxi, recht preiswert. Doch fiel einem dann ein, dass man nach Kaufkraft den Dollar in etwa der Deutschen Mark gleichsetzen müsste. Dabei hatte man daheim beim Geldumtausch für einen Dollar 3,65 DM gezahlt. Vor allem musste man den Curaçao-Likör , aus bitteren Pomeranzenschalen hergestellt, kaufen. Dabei konnte man sich die lästige Umrechnerei in Niederländische Antillengulden sparen. Der US-Dollar galt im Amerikanischen Mittelmeer, wie man die Karibik gern nannte, einfach überall. Die offizielle Währung von Curaçao, der Antillengulden, war genau die Hälfte wert.
Beim Versuch, neben dem Likör etwas für Curaçao Typisches zu kaufen, verriet mir ein Verkäufer, dass alles, was in den wohlgefüllten Souvenirläden feilgeboten wurde, aus Hongkong oder Japan stamme, aus den USA oder den Niederlanden.
»Auf Curaçao«, sagte er voller Stolz, »hat kein Mensch Zeit für kunstgewerbliche Arbeiten. Hier ist man mit dem Ölgeschäft rund um die Uhr voll ausgelastet.«
Читать дальше