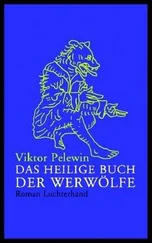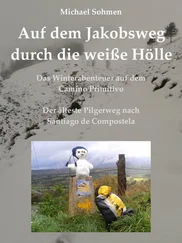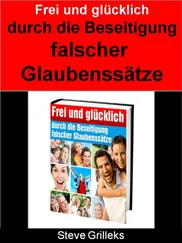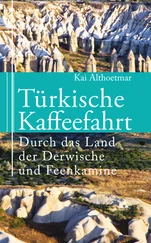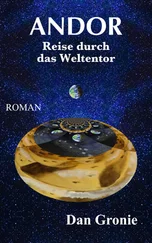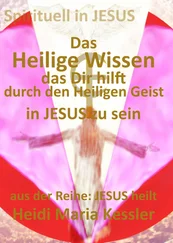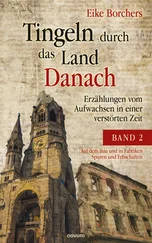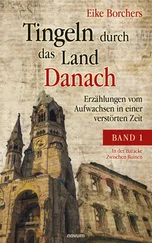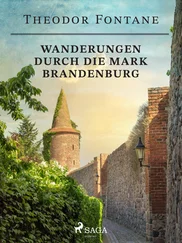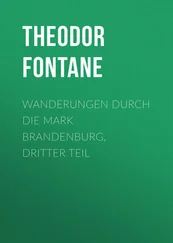Ein Cafe am Rothschild-Boulevard machte einen angenehmen Eindruck. Junge leisere Menschen saßen draußen und drinnen, tranken Kaffee, Bier oder Mixgetränke, unterhielten sich und lachten häufig. Ich rauchte gerade, da fragte mich ein dunkelblonder, ungefähr 25jähriger Mann, ob ich ein Feuerzeug hätte. Ich gab ihm Feuer, er bedankte sich. Er saß mit einem Gleichaltrigen am Nachbartisch, wir kamen ins Gespräch. Er erklärte mir, dass hier am Rothschild-Boulevard in der Schabbat-Nacht das Leben pulsiert. Er kommt aus dem Süden Tel Avivs, da ist es jetzt ruhig, wie es sich normalerweise mitten in der Nacht für den Schabbat gehört.
Er fragte mich, woher ich sei.
Ich antwortete. „Aus der Schweiz.“
Das hatte ich mir zurechtgelegt. Ich weiß, dass von einigen israelischen Familien ein Großteil der Vorfahren von den Nazis vergast oder erschossen wurden. So lange ist das alles nicht her – nur 70 Jahre, viele Erinnerungen der Älteren sind noch frisch. Ich verstehe vollends, wenn solche Menschen nichts mit den Deutschen zu tun haben wollen. Sechs Millionen Juden ermordet, das sind so viele, wie jetzt in Israel leben. Welch grauenhafte Wahrheit.
Amos Oz boykottierte bis Ende der 60er Jahre alles Deutsche bis auf die deutsche Literatur. Mittlerweise ist er besuchsweise gern in Deutschland und hat deutsche Freunde. An den Abenden in Deutschland und Österreich kann er noch immer nicht einschlafen. In anderen Ländern geht es ihm nicht so.
So hatte ich mir also zurechtgelegt, dass ich aus der Schweiz, konkret aus Basel bin. Zu Basel hatte ich mich auch noch belesen. Mit dieser kleinen Notlüge wollte ich einfach schnelle vorurteilslose Gespräche mit Israelis gewährleisten. Ich wollte nicht an der Notlüge festhalten und mich beim näheren Gespräch natürlich als Deutscher outen. Der Leser mag jetzt denken, jetzt verleugnet er sein Deutschtum. Das mag sein. So viele Lügen und Halbwahrheiten begegnen uns Tag für Tag – in der Werbung, in den Medien, bei vielen Mitmenschen. So erlaubte ich mir eben auch diese kleine Notlüge für erste Begegnungen mit Israelis. Man möge die Umstände betrachten und mir verzeihen.
Ich las von einer Israelin, die gut Deutsch spricht und sich im Ausland immer als Österreicherin ausgibt, weil sie es leid ist, mit Wildfremden laufend über den Staat Israel zu diskutieren.
Der junge Mann ging auf meine falsche Identität ein und erwiderte, dass einige Israelis in der Schweiz Skiurlaub machen.
Später fragte ich die jungen Männer, ob sie Aschkenasim seien. Sie waren ganz überrascht, dass ich wusste, was Aschkenasim sind. Nein, sie seien beide Sephardim mit marokkanischen und irakischen Wurzeln.
Die Sephardim sind die Nachfahren der Juden aus Portugal, Spanien, Nordafrika, Jemen, Irak, Iran und anderen Länder dieser Gebiete. Sie sehen den Arabern sehr ähnlich, selbst Insider können sie äußerlich oft nicht von den Arabern unterscheiden.
Die Aschkenasim sind die Nachfahren der Juden aus Mittel- und Osteuropa mit heller Haut, mit dunkelblonden, teilweise hellblonden, rotblonden, schwarzen, aber fast nie pechschwarzen Haaren.
Viele Jahre dominierten die Aschkenasim die israelische Gesellschaft, die Sephardim hatten bei der Erlangung einflussreicher Positionen deutlich schlechtere Karten.
Diese beiden jungen Männer hatten als Sephardim nur einen leichten dunklen Hautteint und die Haare des anderen jungen Mannes waren dunkel, jedoch nicht pechschwarz. Die dunkelblonden Haare des ersteren kamen wohl von einer Tönung. Ihre Eltern beschäftigte die Dominanz der Aschkenasim über die Sephardim sehr. Mittlerweile seien sie aber alle eine große jüdische israelische Familie mit gleichen Chancen für alle.
Ich fragte: „Wenn in einem Krankenhaus ein neuer Chefarzt in irgendeiner Abteilung benötigt wird und es zwei Kandidaten für diese Position gibt, einen aschkenasischen und einen sephardischen Juden. Haben beide die gleichen Chancen heutzutage, den Chefarztposten zu erreichen?“
Sie überlegten kurz und nickten. Ob das immer so sei, sei dahingestellt. Offenbar kannten sie sich nicht im Krankenhaus-Milieu aus. Das war mir auch egal. Mit meiner Frage ging es mir lediglich um die Vergabe führender Posten, egal auf welchem Arbeitsgebiet. Mittlerweile sind die Chancen der Sephardim offenbar besser.
Ich fragte noch, wann denn die Sonne aufgehen wird.
„Ungefähr 6:00 Uhr morgens.“
Ich beschloss, etwas den Rothschild-Boulevard bei Nacht zu erkunden und mich dann einfach eine halbe Stunde an den Strand zu legen und die Augen eine halbe Stunde zuzumachen. Ich habe gute Erfahrungen mit solchen kurzen Regenerationspausen. Während der beiden Flüge schlief ich etwas, dennoch ist mein Biorhythmus leicht vergewaltigt und ganz frisch fühle ich mich nicht. Von den ärztlichen Bereitschaftsdiensten kenne ich das. Mit steigendem Alter habe ich ein zunehmendes Bedürfnis nach einem stabilen Tag-Nacht-Rhythmus. Zum Glück muss ich nicht regelmäßig ganze Nachtschichten schrubben.
Die Bauhausarchitektur des Rothschild-Boulevards bewunderte ich im Halbdunkeln, am Ende des Boulevards steht das Nationaltheater Habimah mit einem großen freien Platz davor. Die zwei jungen Männer traf ich nach einer Stunde nochmals. Die meisten Lokale waren nunmehr geschlossen. Irgendwie musste ich noch die wenigen Stunden bis zum Tagesanbruch vertrödeln. Ich suchte noch ein Lokal, wo ich gemütlich etwas essen und schreiben kann und so bin ich hier bei McDonald’s gelandet.
5:40 Uhr, ich habe eine reichliche Stunde intensiv geschrieben und kaum aus dem Fenster geschaut. Draußen kommt Tageslicht auf und ich sehe den Rothschild-Boulevard erstmalig bei Tageslicht.
Auf, auf zum berühmten Strand von Tel Aviv! Hoffentlich rauscht das Meer. Als Landei liebe ich das Meerrauschen. Ich war schon mehrmals an der Nord- und Ostsee, als das Meer mehrere Tage nicht rauschte – deprimierend. Da hätte ich mich auch an das Ufer einer Thüringer Kiesgrube setzen können.
11:20 Uhr: Ich sitze in einem Cafe unweit der Küste. An einem Tisch schreibt es sich eben doch am besten. Mit übergeschlagenen Beinen auf einer Bank ist es unbequemer.
Wieder ist vieles in den letzten Stunden passiert. Am Meer gegen 6:00 Uhr angekommen, freute ich mich, dass das Meer ein bisschen rauscht. Erstaunlich viele Menschen joggten schon an der Uferpromenade und auf dem vom Meer überspülten Sandstreifen.
Eigentlich mag ich das denglische Wort „joggen“ nicht. Nun, „dauerlaufen“ oder „waldlaufen“ sind aus der deutschsprachigen Mode gekommen. Für das englische Wort Pullover, gibt es kein deutsches Wort. Übersetzt bedeutet Pullover „Überzieher“, kein Mensch sagt Überzieher. Sprache verändert sich, hoffentlich wird die schöne deutsche Sprache nicht ganz abgeschafft.
Ich legte mich an den Strand mit meinem kleinen Rucksack unter dem Kopf, schloss eine Viertelstunde die Augen und war wieder halbwegs frisch.
Dann spazierte ich den Strand entlang. Hier gibt es jetzt Ende April schon viele kastanienbraune Menschen und sie aalen sich weiter in der Sonne. Haben die noch nichts vom Hautkrebs gehört? Na ja, ich rauche auch und habe auch schon vom Lungenkrebs gehört.
Ich schaute zwei Anglern zu und fragte, ob sie schon Fische gefangen hätten.
Der eine erwiderte scharf: „Not po russki“. Das war ein kurzer englisch-russischer Brocken, bedeutete „nicht auf Russisch“ und bedeutete hier eindeutig: Wir sprechen hier kein Russisch, verstehe das bloß, du Depp!!
Wie ich schon im Vorfeld erfahren habe, sind seit 1989 rund 1Million Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewandert. Das sind immerhin etwa 13% der israelischen Bevölkerung – ein ziemlich großer Anteil. Ich las auch Publikationen, wo der Anteil noch höher beziffert wird. Teilweise ist deren jüdische Herkunft umstritten. Viele assimilieren sich nicht so richtig in die israelische Gesellschaft, sprechen vorwiegend russisch, lernen kaum hebräisch. Einige sehen Israel als Sprungbrett an, um im Weiteren in den USA oder in Deutschland zu leben. An deren Stelle wüsste ich auch nicht, warum ich da hebräisch lernen soll. Ein Teil der israelischen Bevölkerung mag diese Einwanderer nicht, was ich bei diesem Angler spürte.
Читать дальше