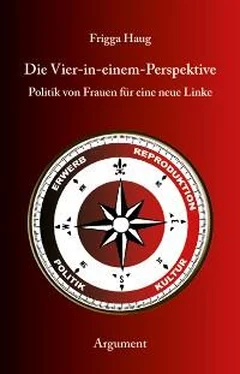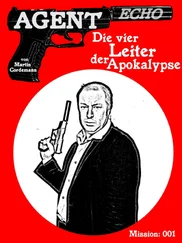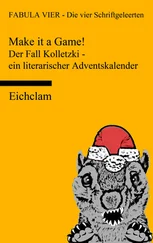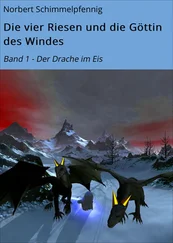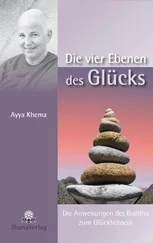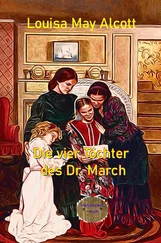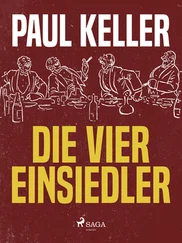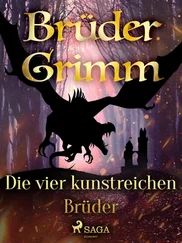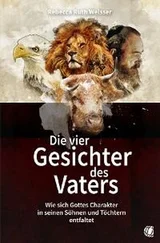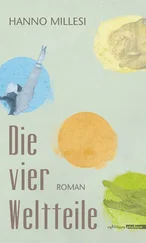1 ...8 9 10 12 13 14 ...27 Die Perspektive der »freien Tätigkeit« wird als Prozess gefasst: es geht um das Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit. Das Moment der Notwendigkeit in der materiellen Produktion soll so immer weiter zurückgedrängt werden zugunsten des freiheitlichen Moments von Selbsttätigkeit. Im Reich der Notwendigkeit wird Arbeit ein Verteilungsproblem – alle sollen Arbeit aus Not zu gleichen Teilen bewältigen; im Reich der Freiheit geht es um eine andere Art von Tätigkeit, in der die herkömmliche Arbeitsteilung, insbesondere die von Kopf- und Handarbeit, nicht gilt. Der Weg geht über die Entwicklung der Produktivkräfte, die den Notwendigkeitscharakter bei der Erzeugung des materiellen Lebens ermäßigen; und er geht über die Entzweiung der menschlichen Arbeit, ihre Entfremdung. Die entfremdete Arbeit muss gewaltsam aufgehoben werden, dadurch dass der Mensch sich die von ihm geschaffenen Produktivkräfte schließlich aneignet, dies im umfassenden Sinn. Umgewälzt werden müssen die gesamten Produktionsverhältnisse, die die Verkehrung der menschlichen Gattung so weit trieben, dass alle Entwicklung, aller Reichtum, Kultur, die gegenständlichen Arbeitsbedingungen sich gegen die Arbeitenden versachlichten und zur Macht über sie wurden. Dieser Widerspruch kann nur durch einen Bruch in eine neue Form gebracht werden. In der Kritik des Gothaer Programms skizziert Marx die Stufe der genossenschaftlichen (gesellschaftlicher Besitz der Produktionsmittel) Gesellschaft, die – eben weil sie aus der kapitalistischen hervorgeht – die Muttermale dieser Gesellschaft trägt: »in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig«. Dann entwirft er als höhere »kommunistische Gesellschaft« ein Gemeinwesen, welches die Verkehrungen der Arbeit überwunden hat, und erst in diesem Zusammenhang fällt die Äußerung von der »Arbeit als erstem Lebensbedürfnis«.
»[…] nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!« (MEW 19, 21)
Diese Äußerung hat zu vielerlei Einseitigkeiten beigetragen. Neben der Vorstellung, Individuen, denen eine »arbeitsscheue« Haltung attestiert wird, könnten unter Berufung auf Marx zu solchen, denen »Arbeit zum ersten Lebensbedürfnis« wird, erzogen werden, war es auch gerade der Schlussaufruf »jedem nach seinen Bedürfnissen«, der Hoffnung und Befürchtung hervorbrachte, Marx könne eine Gesellschaft herbeigesehnt haben, in der die Bedürfnisse, die durch Kapitalismus und Überflussproduktion auf der einen Seite, Armut auf der anderen formiert sind, zum Maßstab gesellschaftlicher Regelung genommen würden. Dabei ist der Kontext eindeutig: Wenn es den Menschen gelingt, sich aus materieller Not und Herrschaft zu befreien, dann ist die Erzeugung des materiellen Lebens ihnen produktiver Genuss und Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Dieses Bedürfnis werden sie leben können und insofern ihr Menschsein verwirklichen. Das schließt die Aufhebung jener Arbeitsteilungen ein, die die Entzweiung der menschlichen Arbeit als Grundlage von Gesellschaftsformationen hervorbrachten: die Teilung in Hand- und Kopfarbeit; in Männer- und Frauenarbeit; in Arbeit und Nichtarbeit. Beziehen wir das bis hierher Entwickelte auf die im ersten Teil entstandenen Fragen:
Der Arbeitsbegriff
Das Selbstverständliche und beim Reden über Arbeit zugleich immerfort Vergessene scheint mir, ihren Formcharakter zu beachten. Die unterschiedslose Weise, in der über Arbeit gesprochen und gedacht wird, ist Quelle der meisten Missverständnisse. Wir sprechen über Lohnarbeit, nennen sie Arbeit und kritisieren die Rede von der Arbeit als erstem Lebensbedürfnis. Und umgekehrt: Die Erziehung zu diesem ersten Lebensbedürfnis ist nicht nur in sich widersinnig, sondern zumeist auch nur Erziehung zur Lohnarbeit in den verschiedenen Ausprägungen, ununterscheidbar von einem Unterwerfungskonzept in Industriebetrieben. Wenn wir die »Substanz« meinen, die in unserer heutigen Gesellschaft hauptsächlich die Gestalt der arbeitsteiligen Lohnarbeit angenommen hat, sollten wir vorläufig umständlich von der »Selbstbetätigung in der Erzeugung des materiellen Lebens« sprechen.
Arbeit als Systembegriff?
Die Versuche, insbesondere von Offe (1984) und Habermas (1985), Arbeit aus dem Zentrum von Gesellschaftstheorie zu rücken, werden verständlicher, wenn man zuvor unterstellt, Marx habe eine Gesellschaftstheorie hegelscher Art entworfen, in der er an die Stelle des Geistes die Arbeit setzte (so etwa Rüddenklau 1982, aber auch Bischoff 1973, 323: »In der Entwicklungsgeschichte der Arbeit liegt der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Geschichte der Gesellschaft.«). Marx schrieb dagegen über die Verhältnisse, durch die die Selbstbetätigung der Menschen verschiedene Formen annimmt: solche der Verkümmerung der Individuen, ihrer äußersten Entfremdung in der Arbeit, deren Verkehrung in Negativität. Wesentlich ist dabei die Arbeitsteilung. In der Herrschaftsanordnung wird solche Teilung naturwüchsig, heftet sich an zufällige körperliche Eigenarten. D. h., sie verbindet sich mit den Personen ein Leben lang, gehört ihnen an wie eine Sache, sodass selbst das Bewusstsein einer »freien Tätigkeit« verschwindet. Die Arbeitsutopie habe keine Kraft mehr, sagt Habermas, ins Zentrum rücke die Lebensweise. In allen marxschen Schriften wird deutlich, dass es Marx um die Revolutionierung der Lebensweise ging, die er allerdings durch die Produktionsweise bestimmt sah. Ersetzt man den schillernden Arbeitsbegriff durch seine »Substanz«, so hören sich solche Marx-Verabschiedungen so seltsam an, wie sie sind. Es ginge jetzt nämlich darum, die Erzeugung des materiellen Lebens, also des Lebens selbst und der Lebensmittel, nicht mehr so wichtig zu nehmen, dass Gesellschaftstheorie von dieser Grundlage ausgehe. Hinter den Verabschiedungen steckt die Frage, ob die Erzeugung des materiellen Lebens u. U. herrschaftsförmig geregelt bleiben könnte und gleichwohl menschliche Entwicklung und menschliches Glück möglich wären, Befreiung also auf Lebensausschnitte beschränkt bleiben könne. Das Problem, auf das so geantwortet wird, ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass in unseren kapitalistischen Gesellschaften revolutionäre Umgestaltung möglich sei und horizontale Vergesellschaftung machbar. Die Wirklichkeit von neuen sozialen Bewegungen mit Alternativprojekten hier und heute scheint den Ausschnitt-Lösungen recht zu geben. Die sich stets zuspitzende Katastrophenlogik kapitalistischer Gesellschaften im Weltmaßstab zerschlägt aber die Illusion, eine lebenswerte Zukunft ohne Einfluss auf die Rahmenbedingungen des Handelns im Großen zu haben. Es scheint mir dabei übrigens kein Zufall zu sein, dass die Frauenbewegung zwar zunächst immer als eine der sozialen Bewegungen genannt, bei der weiteren Diskussion aber sogleich vergessen wird. Denn ihre Fragen sind ohne die Aufhebung aller Herrschaft und Arbeitsteilung nicht lösbar.
Die Frage an die Kritische Psychologie
Es bleibt die Frage des frühen Milchholens. – Aus meinen arbeitsbiographischen Notizen wie aus meinen theoretischen Studien bin ich zu dem Resultat gekommen, dass die Lust zur Arbeit ebenso wie ihre Meidung, dass die Subbotniks und die Drückebergerei aus dem gleichen Stoff gemacht sind. In den Strukturen des gesellschaftlichen Lebens entwickelt sich eine blinde Dialektik. Unversehens und unkontrolliert schlägt die Begeisterung für die Arbeit um in ihr Gegenteil. Die praktische Lösung, das Leben außerhalb der Arbeit zu suchen, stößt allenthalben an Grenzen und ebenso an Überschreitungen. Die theoretische Lösung, Arbeit und Lebensweise getrennt zu denken, verrät die Perspektive der freien Selbstbetätigung, indem sie sie außerhalb der entfremdeten Arbeit einzulösen verspricht. Der Begriff der (verallgemeinerten) Handlungsfähigkeit in der holzkampschen Wendung könnte eine Bewegungsform für die blinde Dialektik von Arbeit und Faulheit sein, in der eine bewusste Entwicklung gedacht werden kann; das Auseinanderfallen von Arbeit und Lebensweise kann hier als historisches Produkt mit der Perspektive seiner Überwindung gefasst werden. Voraussetzung dafür wäre allerdings, die Dimensionen aufzunehmen, die Marx mit »Arbeit als erstem Lebensbedürfnis« vortrug. Die Erweiterung der Handlungsfähigkeit ist sicher Vorbedingung dafür, dass »freie Tätigkeit« möglich wird, aber wie und unter welchen Verhältnissen können die Menschen ihr materielles Leben so gewinnen, dass sie es nicht zugleich verlieren, sondern dass es Genuss, Lust, Liebe, Entwicklung, Gemeinwesen ist? Arbeit und Genuss sind durch Arbeitsteilung auseinandergetreten, heißt es in der Deutschen Ideologie (vgl. MEW 3, 32). Sie wieder zusammenzubringen bleibt Befreiungsperspektive.
Читать дальше