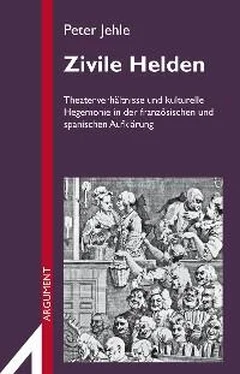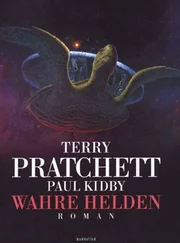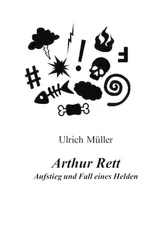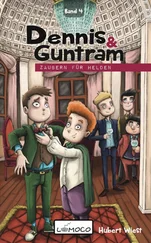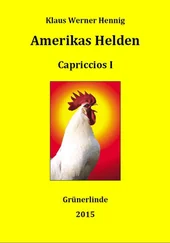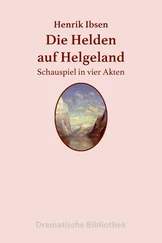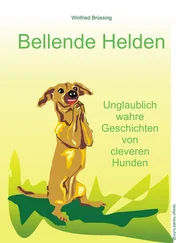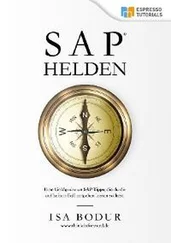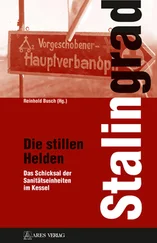Was Fischer-Lichte als das Neue beschreibt, das einzig durch eine »Ästhetik des Performativen« adäquat zu verstehen sei, beherrscht das Theater bis zu dem Moment, da die Literarisierung die Aufführung erreicht und diejenige Rezeptionsform verallgemeinert, die das Zuschauen zur sinnverstehenden Aktivität macht. Solange das Theater selbst ein Ereignis war, bei dem der zur Aufführung kommende Text, mithin sein literarischer Anteil weder von der Seite der Schauspieler (die lieber improvisierten als eine Rolle auswendig lernten) noch von der der Zuschauer im Mittelpunkt stand, galt auch hier, was Fischer-Lichte für die moderne Performanz-Kunst konstatiert, dass »der Körper- bzw. Materialstatus den Signifikantenstatus« überlagerte (2004, 24). Wenn Performance- und Aktionskunst seit den 1960er Jahren als das unerhörte Neue erscheinen können, so deshalb, weil das Dispositiv des literarischen Theaters – trotz der immer wieder vorgetragenen Angriffe seit Beginn des 20. Jahrhunderts – Theatralität auf die mit ihm selbst unauflöslich verbundenen Erscheinungsformen festlegte und alle übrigen Formen als defizitär, illegitim, seinen hochkulturellen Anspruch verfehlend abqualifizierte. Die »Ästhetik des Performativen« geht gewissermaßen den Weg zurück vom literarischen Theater zum Theater als Ereignis, dem keine von seinem ›Schöpfer‹ unabhängige Existenz zukommt und in dem das Gezeigte sich im Vorgang des Zeigens selbst verzehrt. Die Trennung von Schauspielern und Zuschauern, die das literarische Theater voraussetzt, um die Zeichenhaftigkeit der auf der Bühne dargestellten Welt entziffern zu können, wird überflüssig, wo die körperliche Präsenz der Akteure dem Zuschauer auf den Leib rückt und weniger ein ›Verstehen‹ als ein ›Erfahren‹ provoziert (vgl. ebd., 19). Die Ästhetik des Performativen trägt die Elemente zusammen, die seit 150 Jahren unter der Dominanz des literarischen Theaters zu einer Randexistenz verurteilt waren. Es ist, als hätten sich Schauspieler und Zuschauer nach so langer Zeit der Trennung durch die ›vierte Wand‹ allererst ihrer wechselseitigen Präsenz wieder versichern müssen. Der »Performativierungsschub« (Fischer-Lichte 2004, 25), den das Theater – aber auch musikalische Aufführungen oder Lesungen – seit den 1960er Jahren erfuhr, etwa in Handkes Publikumsbeschimpfung10, bezeugt dieses Bedürfnis.
Wenn man der traditionellen Literaturgeschichtsschreibung zu Recht vorwerfen konnte, sie reduziere Kulturelles auf Artefakte, die den Sprung in die literarische Existenzform geschafft haben, so tendiert eine Ästhetik des Performativen dazu, überall ›Kunst‹ zu entdecken und Wirklichkeit nur mehr als inszenierte gelten zu lassen. Die Abstraktion des Literarischen setzte ein Gefüge voraus, in dem der Text und damit die Kompetenz, Texte auszulegen, als oberste Instanz institutionalisiert war. Wie sich das Auslegen von Texten nicht außerhalb der Materialität von Institutionen, Praxen und Diskursen bewegt, die ein ›hermeneutisches Dispositiv‹ bilden, in dem sich der ›Sinn‹, d. h. die geschichtliche Geltung einer Aussage oder Auffassung konstituiert, so die Abstraktion des Performativen. Die Privilegierung des Ereignishaften, mittels einer englischen Vokabel zum ›event‹ gesteigert, ist unverkennbar Reaktion auf einen Zustand, in dem die real existierende Kluft zwischen Ereignis und Dabeisein immer größer geworden ist, auch wenn (oder gerade weil) die Bilder in Echtzeit übertragen werden und der heimische Bildschirm die Dimensionen einer mittelgroßen Leinwand angenommen hat. Die Figur des befugten Interpreten, der immer neue Texte, Kommentare, Erläuterungen lieferte (vgl. Jehle/Orozco 2004), wird im neuen Paradigma durch den Reporter abgelöst, der mit der Kamera, dem Repräsentanten des Zuschauers, die Welt durchstreift und immer neue Ereignisse liefert.
Die Metaphorisierung des Theater-Begriffs, die ihre Evidenz aus einer »Theatralisierung und Ästhetisierung unserer Lebenswelt« (Fischer-Lichte 2004, 316) bezieht, läuft Gefahr, die inszenierten Wirklichkeiten als »Wiederverzauberung der Welt« (315) zu verklären, in der sich die »›Eigenbedeutung‹ von Mensch und Dingen« enthüllt (325). Wo aber die ›kulturelle Wende der Geisteswissenschaften‹ die Begriffe Herrschaft und Ideologie durch Kultur oder, noch kurzatmiger, durchs ›Ereignis‹ substituiert, statt in der Kultur die Spuren und Modi der Auseinandersetzung um Herrschaft, um Herrschaftssicherung von oben bzw. um die Erweiterung gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit von unten zu entziffern, können die wirklichen Kämpfe, die in einer Gesellschaft ausgetragen werden, nicht in den Blick kommen. Die vorliegende Studie versteht sich dagegen als Beitrag zu einer sozialgeschichtlich fundierten Kulturwissenschaft, die die Herkunft ihrer Maßstäbe aus einer ideologiekritischen Sicht der Gegenwart nicht verleugnet.
Ich danke Thomas Barfuss, Ruedi Graf und Manfred Naumann für wertvolle Anregungen und die aufmerksame Lektüre des Typoskripts. Das theoretische Fundament zu dieser Studie ist durch das Projekt Ideologie-Theorie gelegt worden. Wenn sich die Früchte meiner damaligen Bemühungen, eine Studie zur Entstehung des französischen Staatstheaters, die im letzten Band der PIT-Reihe erschienen ist (AS 111, Der innere Staat des Bürgertums, 1986), auch nach Jahren noch als genießbar erwiesen haben, so zeigt das nicht zuletzt, wie viel die neue Arbeit dem alten Projektzusammenhang, insbesondere Wolfgang Fritz Haug und Jan Rehmann, verdankt.
Teil I
Frankreich
1 Die Eroberung des Theaters durch die Literatur
Einer Zeit, in der eine global organisierte Illusionsindustrie ihre Bilder vom besseren Leben bis in die Wellblechhütten ohne Wasser-, aber mit Fernsehanschluss sendet, muss das Theater des 18. Jahrhunderts als ein lächerlich mangelhaftes Produkt zur Befriedigung der Schaulust erscheinen. Mehrere Hundert im Parterre frei umherschweifende, ausschließlich männliche Zuschauer, die der Bühne nicht selten den Rücken zukehren, weil hinten im Saal gerade das interessantere Schauspiel stattfindet; Sitzplätze auf der Bühne, dem Lieblingsaufenthalt eingebildeter »petits-maîtres«, die alles tun, um sich selbst in Szene zu setzen; die rechteckige Form des Saales, die denjenigen Logenbesuchern, die tatsächlich das Bühnengeschehen verfolgen wollen, einen steifen Hals beschert11; schließlich eine Luft zum Schneiden und eine Saalbeleuchtung, die jedes Gesicht in einen Halbschatten taucht, »qui détourne l’attention et impose à chaque individu l’existence de ses voisins« (Lagrave 1972, 417) – wir sind im 18. Jahrhundert noch weit entfernt von jenen Momenten »vollkommener Illusion«, die sich Stendhal gewünscht und auf deren Erlebnis er das »dramatische Vergnügen« beziffert hat.12 Claude-Nicolas Ledoux spricht die Erfahrung eines ganzen Lebens aus: »Nos théâtres […] sont encore dans l’enfance de l’art et laissent beaucoup à désirer« (1804, 222). Die aus langgestreckten Ballspielsälen hervorgegangene Bauweise versagt genau in dem Punkt, auf den es ankommt: »de voir par-tout et d’être bien vu« (222). Es genügt, sich von dem Schauspiel anregen zu lassen, das sich auf den öffentlichen Plätzen bietet: »Traversez la place publique, que voyez-vous? Un charlatan qui attire la curiosité des passants, et les appelle au son des clairons […]. Ses bruyants accords amassent la multitude qui se pelotte en foule autour de lui. On l’entoure de rayons égaux; le plus fort l’approche de plus près; le plus faible est plus éloigné. Toutes les places sont bonnes; toutes tendent à un seul point.« (223) Der Halbkreis, den die Menge um den Marktschreier bildet, ist zugleich die einzige Form, »qui laisse la possibilité de découvrir toutes les scènes du théâtre« (ebd.). Doch vorerst ist das Stehparkett ein »parc moutonnier […] où nos semblables, où l’espèce la moins favorisée de la fortune, est tellement saccadée, comprimée, qu’elle sue le sang; elle répand autour d’elle une vapeur homicide« (219).
Читать дальше