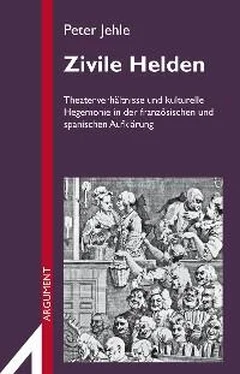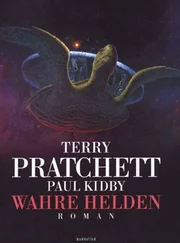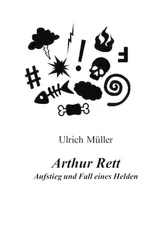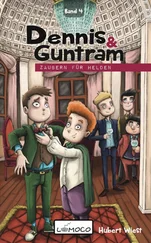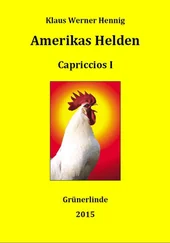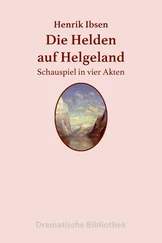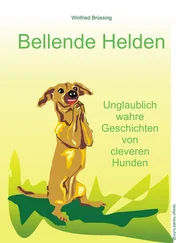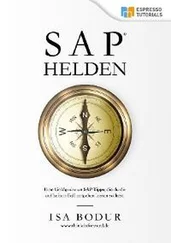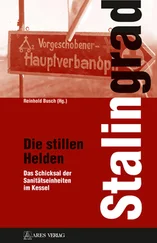Die jüngsten Bestrebungen, die den Ereignischarakter von Theater und anderer Phänomene von Theatralität aus der Zerstreuung sammeln, um sie zu einer »Ästhetik des Performativen« auszuarbeiten (Fischer-Lichte 2004), können umgekehrt das Bewusstsein für den Prozess der Literarisierung der Theaterverhältnisse schärfen. Wolfgang Orlich hat am Beispiel des drame bourgeois gezeigt, dass der Umbau des Theaters zu einem perfekten Illusionsraum beide Seiten verändern muss: den Text wie die Aufführungspraxis. Es geht also darum, die »widersprüchliche Einheit und Veränderung von poetologischer Reflexion des Dramas und Theaterpraxis in ihrem gegenseitigen Bedingungsverhältnis« zu untersuchen (Orlich 1984, 432). Für den »Stückeschreiber« Brecht ist das Schreiben nur der erste Entwurf; die eigentliche Produktion des Stücks findet auf der Bühne statt.2
Bei der Suche nach einem Theaterkurs für ihren 12-jährigen Sohn musste Hélène Merlin-Kajman feststellen: »les cours insistent tous sur l’approche ludique du théâtre […], le corps constituant évidemment aux yeux de tous le vecteur d’un épanouissement spirituel. De texte, il est rarement question.« (2005, 13) Ausdrücklich wird den Eltern versichert, dass die Kinder weder mit Molière noch Racine traktiert werden. Es ist, als folgte auf die Privilegierung des Textes die Privilegierung des ›Körpers‹. Die Entgegensetzung von Körper und Text, die letzteren zu einem bloßen »prolongement spontané de cette présence corporelle immédiatement communicative« entwichtigt (ebd., 14), ist freilich auch bewusstloser Ausdruck einer medienvermittelten Wirklichkeit, in welcher der Text als nicht ablösbar von Stimme und Gestus, die sprechenden und gestikulierenden Körper selbst aber vor allem als auf Bildschirme gebannte Phantome wahrgenommen werden. Demgegenüber ist der Theaterkurs, in dem sich wirkliche Körper und Stimmen begegnen, der Sonntag im Alltag der Mattscheibe. Indem die vorliegende Arbeit die Literarisierung der Theaterverhältnisse in ihrer Geschichtlichkeit – und das heißt immer auch in ihrer Bedeutung für die Gegenwart – zu begreifen sucht, könnte sie dazu beitragen, einige der Einseitigkeiten abzubauen, die im Zuge der ›Kulturalisierung‹ und ›Anthropologisierung‹ der Literaturwissenschaften zum neuen Credo geworden sind.
Nach dem Untergang des mittelalterlichen Spielmanns waren die Schauspieler die wichtigsten Handlungsträger einer profanen Kultur der Mündlichkeit. Daher bietet gerade das Theater vielfältiges Anschauungsmaterial, um den Einschnitt, der die Mündlichkeit von der Schriftlichkeit trennt, in den Blick zu bekommen. Kein Zufall, dass der »Autor« auf diesem Gebiet über Jahrhunderte ein kümmerliches Dasein gefristet hat, allenfalls dem heutigen Drehbuchautor vergleichbar, der neben den Stars auf der Leinwand verblasst. Erst wenn der Text neben die Aufführung tritt und sich Respekt zu verschaffen versteht, erscheint das Theater als doppeltes Medium, das unterschiedlichen kulturellen Logiken gehorcht: Die Aufführung, Element einer Kultur der Mündlichkeit, kann in Widerspruch treten zum Text, der die Zuständigkeit des »Autors« und der »Gelehrten« überhaupt reklamiert und dessen Terrain die Schriftlichkeit ist. Das gilt auch für die Seite der Rezeption. Der Zuschauer hört, sieht und ist stets einer von vielen; der Leser ein Einzelner, auch wenn er seinem Geschäft im überfüllten Lesesaal einer modernen Bibliothek nachgeht, deren Geräuschkulisse ihm die abgeschiedene Studierstube als ein höchstes Gut erscheinen lässt. Die Kollektivität des Theaterzuschauers war über Jahrhunderte ein selbstverständliches Element seines Daseins, in dem sich sein Geschmack, seine Wünsche und Gewohnheiten bildeten. Erst die Modellierung der Aufführung durch den Text, der Umbau der Bühne zur vierten Wand, die Aufspaltung der zuschauenden Menge in einzelne Zuschauer – ihre Individualisierung – mittels Beleuchtung und Bestuhlung rückt die Rezeption im Theater in die Nähe der sinnverstehenden Aktivität des einsamen Lesens.
An der Querelle du Cid, die im Anschluss an die Aufführung von Corneilles Tragikomödie Le Cid 1637 die Anhänger des gespielten Stückes und die Kritiker des gedruckten Textes einander entgegensetzt, lässt sich der Vorgang exemplarisch studieren. Aufführung und Text treten antagonistisch auseinander und machen bewusst, dass eine Literaturwissenschaft, die sich für das Theater nur als Text – d. h. als Medium der Gebildeten, der »république des lettres« – interessiert, reduktionistisch verfährt. Die vielfach praktizierte kulturwissenschaftliche Erweiterung der Literaturwissenschaft gewinnt auf diesem Terrain einen präzisen Sinn: Das materielle Dispositiv der Aufführung – öffentlicher Platz oder geschlossener Raum, die architektonische Gliederung in Bühnen- und Zuschauerraum, die Zerlegung des letzteren in verschiedene Zonen (Parterre, Logen, Sitzplätze auf der Bühne) – bestimmt eine Wirkung, die dem in Gestalt der »doctrine classique« installierten Regulationsmodus ästhetischer Produktivkraft in die Quere kommen kann: Den Zuschauern gefällt, was die Doktrin verurteilt und der Gelehrte, der sich in seiner Studierstube über den Text beugt, aufs Prokrustesbett der Poetik spannt.
Der Aufschwung der dramatischen Literatur im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts in Frankreich, dessen vorläufigen Höhepunkt der Cid markiert, schien im Widerspruch zum Fehlen eines festen Theaters in Paris zu stehen (Mongrédien 1966, 47). Diese Auffassung vergaß den Abgrund, durch den die Kulturen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die Volkskultur und die humanistische Kultur einer an der Antike orientierten Gelehrsamkeit voneinander getrennt waren.3 Von diesem Standpunkt, für den feststeht, dass der Cid den Ausgangspunkt der klassischen Literatur bildet, stellt sich die Seite der Aufführung als defizient dar – nicht zu Unrecht, wenn man die Aufführung als bloße Applikation des Textes unterstellt. Davon geht auch Voltaire aus, wenn er immer wieder beklagt, dass in Frankreich zwar exzellente Theaterstücke geschrieben wurden, aber die materiellen Bedingungen fehlen, die ihnen Geltung verschaffen könnten.4 Was nützen die besten Verse, solange die petits-maîtres auf der Bühne ihnen den Respekt versagen? Die vorliegende Arbeit macht daher die Entstehung einer bestimmten Anordnung von Aufführung und Text zum Gegenstand. Die Zentralstellung des Textes, in seiner doppelten Gestalt als Lehre und Einzelwerk, ist als Vorgang der Literarisierung der Theaterverhältnisse zu untersuchen und in seinen Folgen für die Kämpfe um die kulturelle Hegemonie im Ancien Régime zu beurteilen.
Aber es ist nicht nur das Verhältnis von Aufführung und Text, die kulturellen Logiken von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, welche die Schauspieler den Autoren, die Kritiker den Zuschauern usw. entgegensetzt. Die Medien der Mündlichkeit und Schriftlichkeit bilden keineswegs kulturell homogene Räume. Wie das Lesen Element einer popular-kollektiven5, nicht nur einer gelehrt-individualistischen6 Kulturpraxis sein konnte, so umgekehrt das szenische Spiel Element einer abgeschotteten Gelehrtenkultur (Jesuitentheater). Was als Höhepunkt der deutschen Literatur gilt, kann seine Herkunft aus der Popularkultur nicht leugnen: Schon Hermann Reich hat bemerkt, dass in Goethes Faust, den der Dichter als Puppenspiel kennengelernt hat, »die alte Mischung der Sprache des Volkes und der Vornehmen« lebendig geblieben ist (1903, 883). Die Verbreitung der mündlich vorgetragenen Romanzen in losen Blättern (pliegos sueltos) oder in billigen Sammlungen (pliegos de cordel), die man bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts an Kiosken in Madrid – neben Feuerzeugen, Schnürsenkeln, Schuhcreme und anderen Dingen des Alltags – wohlfeil erwerben konnte (vgl. Caro Baroja 1969/1990, 13), stellte ihren popularen Charakter durchaus nicht in Frage. Erst vom Standpunkt einer ideologischen Ordnungsmacht wie der Inquisition, die die Reinheit der Lehre gegen unzulässige Vermischungen repräsentiert, stellt sich die Weltauffassung eines Müllers um 1600 als »explosive Mischung« von »schriftlichem Text und mündlicher Kultur« dar (Ginzburg 1983, 84). Die unzulässige Mischung ist nichts, was unabhängig von solcher Intervention existieren würde.
Читать дальше