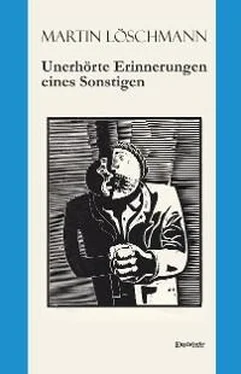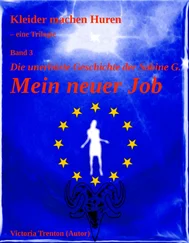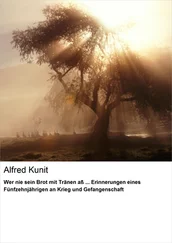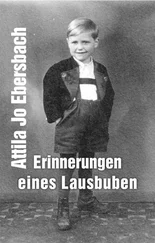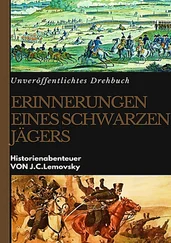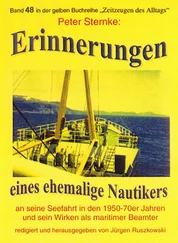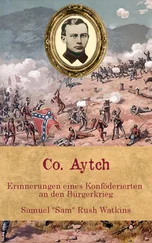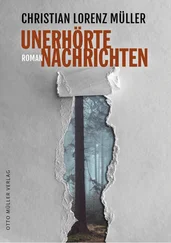An Dietrichs Heimaturlaube erinnere ich mich. Aufregendes Ereignis in der Familie jedes Mal. Einmal berichtete er über den Einsatz an der Ostfront, über die erbitterten Kämpfe, den nicht erwarteten Widerstand der Russen und über den Partisanenkrieg. In einem solchen Krieg kämen selbst sie nicht ohne Grausamkeiten aus: Ein altes Mütterchen habe man in der Nähe von Kiew erschossen, einzig und allein, weil sie am Straßenrand an einem Feuer gesessen und damit angeblich den Partisanen Zeichen, Rauchzeichen gegeben habe. Der vage Verdacht genügte, um sie zu erschießen. Immer wenn ich in der Sowjetunion, später in Russland war – und das war nicht selten – und Babuschkas am Straßenrand hocken sah, wo sie irgendetwas, ein paar Äpfel oder Zwiebeln verkauften, musste ich an das Mütterchen von Kiew denken. Obwohl man genügend über die Gräueltaten der deutschen Soldateska erfahren hat, die von Dietrich geschilderte hat sich tief in mein Kinderherz eingegraben.
Er hatte unbedingt zu den Fliegern gewollt, doch eine kaum merkliche Kurzsichtigkeit des linken Auges verhinderte seinen Eintritt in die gefragte Waffengattung. Vetter Hans Gutzmer dagegen bestand das Aufnahmeverfahren und lief dem Infanteristen im Dorf den Rang ab – Fliegen und Siegen. Als er im Februar 1944, gut ein Jahr vor Kriegsende, als Staffelkapitän des Kampfgeschwaders 51 mit dem Ritterkreuz dekoriert wurde, trennten Welten die beiden Cousins. Mein Vater mochte das wohl nicht gern gesehen haben, jedenfalls hätten sich des Ritterkreuzträgers Eltern beim Bürgermeister beschwert, dass die hohe Auszeichnung im Dorf nicht angemessen gewürdigt wurde.
Mein Bruder war auch als Infanterist begeistert in den Krieg gezogen. In seinem Abschiedsbrief schrieb er: „Fürs Volk und Vaterland. Es gibt nichts Schöneres als vor dem Feind zu fallen.“ Spontan möchte man ihm mit Arno Schmidt entgegenschleudern: „Ehe du für dein Vaterland sterben willst, sieh dir‘s erst mal genauer an!“ Bis heute ist mir der Satz vom schönen Heldentod unfassbar. Nichts gegen Sätze wie: Es gibt nichts Schöneres als lieben und geliebt zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als am Abend ein köstliches Bier zu trinken. Es gibt nichts Schöneres, als eine Arbeit, die einen ausfüllt. Es gibt nichts Schöneres als dem Schweigen eines Dummkopfs zuzuhören (wo hab‘ ich das bloß her?). Ja, ich begreife selbst Ilja Ehrenburgs Äußerung aus dem Jahre 1942: „Wenn du einen Deutschen getötet hast, bring den nächsten um – es gibt nichts Schöneres als deutsche Leichen.“
Auf der Straße vor dem Haus waren wir schnell von vier, fünf Dorfbewohnern umringt, die uns offensichtlich freundlich gesinnt waren, fragten, wie es den Löschmanns ergangen sei. Unter ihnen der Pole von gegenüber, bei dem ich fast zwei Jahre als Pferdejunge gearbeitet hatte. Der Teufel muss mich geritten oder die Verklärung der Kinderzeit mich überwältigt haben, als ich ihm gegenüber ein, mein krönendes Lebensresümee gebe: „Wissen Sie, meine schönste Zeit war eigentlich die nach dem Krieg bei Ihnen: keine Schule, Pferde füttern, striegeln, aus- und anspannen, reiten, pflügen und die herrlichen Ausfahrten am Wochenende. Erinnern Sie sich? Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. “ Das war sein Lieblingslied, er sang es immer, sobald ich ihn, meistens eine Frau neben sich, von Hochzeiten, Kindtaufen, Begräbnissen nach Hause kutschierte. Ich geriet in Fahrt, wurde aber jäh gebremst, denn sein Gesicht versteinerte förmlich. Zu spät. Mit dem knappen Hinweis, er habe zu tun, verließ er abrupt die Runde. Offensichtlich hatte ihn ein Schuldgefühl den Perspektivwechsel nicht mit vollziehen lassen. Wie hätte ich mit zehn die Schule vermissen sollen? Mit Pferden selbstständig umzugehen war für einen Bauernjungen das größte Glück. Was scherte mich, wem Haus und Boden gehörten. Noch in Zeitz hätte ich davon geschwärmt, Bauer zu werden, schreibt Irla, „und sei es auf einem ganz kleinen Hof wie dem von Knuths in Bernsdorf.“ Von dieser Sehnsucht ist nichts übrig geblieben. Bernsdorf kein Sehnsuchtsort.
Ich glaube es manchmal fast selbst nicht, wenn ich von diesen Nachkriegsjahren in Polen erzähle. Ich soll mit meinen 11 Jahren eine Kutsche mit zwei Pferden über Stock und Stein gelenkt, einen Mann kutschiert haben, der Zuchthaus und KZ überlebte, nach dem Krieg zum Besitzer eines Hofes gemacht worden war und nur eines im Kopf hatte, nach all den Entbehrungen in vollen Zügen zu genießen. Unglaublich, hätte ich nicht in meinem 68. Lebensjahr in Myanmar mit eigenen Augen gesehen, was Kinder oft schon leisten müssen: harte Garten- und Feldarbeit, stundenlanges Sitzen beim Zigarrenwickeln, Teppichknüpfen, Krabbenpuhlen, Steine klopfen im Steinbruch. Kinderarbeit, die es nicht und nirgends geben dürfte.
Julika, die mit ihren 14 Jahren bis dahin keine nennenswerte körperliche Arbeit verrichtet hatte, konnte es nicht fassen und verdrehte die Augen ungläubig, als ich berichtete, wie ich als Achtjähriger allein Kühe hütete, dass wir Kinder bei vielen Tätigkeiten auf dem Hof zugreifen mussten. Im Frühjahr und Herbst sammelten wir Steine von den Feldern. Sie kamen in große Körbe, die möglichst gut gefüllt zum Wegesrand geschleppt wurden. Thomas Mann schrieb einmal an Arnold Schönberg: „Ich kann von meinem Stein nicht lassen.“ Er hatte ihn bei einem Strandspaziergang auf Usedom gefunden, schleppte ihn seither mit sich herum, wo immer sein Schreibtisch stand, in München, Los Angeles, Kilchberg bei Zürich. Für mich waren Steine lange Zeit etwas Bedrohliches im wahren Sinne des Wortes Belastendes. Erst im Alter habe ich mich am Sammeln beteiligt: Steine aus Algerien, Australien, Brasilien, England, Griechenland, Schottland, Schweden, Ungarn, von der Ostsee, vom Baikalsee, vom Flussufer des Ob, aus den Rocky Mountains, von der Halbinsel Sinai, aus Oman, von überall her liegen auf der kleinen Dachterrasse in Berlin. Steine als Metapher für Stärke, Steine, die zum Sprechen gebracht, aus dem Weg geräumt werden können, müssen, Steine als Gedächtnisstütze. Spur der Steine von Erik Neutsch, Skulpturen aus Stein gehauen, Werner Stötzers Sandsteingestalt an der Mole in Warnemünde, Penelope, auf Odysseus wartend, mit dem Blick nach Osten, ein gestalteter Stein für all jene Seemannsfrauen, deren Männer nicht mehr heimkehrten. Es dauerte Jahre, ehe die Rostocker Behörden die Aufstellung des Denkmals erlaubten. Man wollte nicht öffentlich wahrhaben, dass der Tod, der aus dem Meer kommt, die DDR nicht umschiffte und immer wieder Seeleute auf dem Meer blieben. Als ob es das Sterben im Arbeitsprozess nicht geben durfte. Grabstein, bloß keinen Grabstein.
Wenn irgend möglich, musste ich unsere Kühe auf Wiesen und Felder treiben, nicht selten ein, zwei Kilometer weit, und das zweimal am Tage. Die Tiere wurden nicht draußen auf der Weide gemolken, wie es heute üblich ist, sondern im Stall. In diesem Punkt gab es zumindest bei meinem Vater ein Erkenntnisdefizit: Kühe, die am Tage 4 bis 6 km laufen, geben weniger Milch als die, die im Sommer draußen, z.B. auf der Alm bleiben. Da es keine eingezäunten Weiden gab, bedurfte es eines Kuhjungen, eines Hirten. Der kleine Steppke, sein Schäferhund Rolf und die Kühe, ja, ich wurde bewundert und genoss die Bewunderung, bis mich eine meiner Schwarz-weiß-Gefleckten im wahrsten Sinne des Wortes überrannte. Es war an einem sehr heißen, schwülen Tag im Juli 1944, als eine Kuh, die gerade noch lethargisch herumgestanden hatte, ab und an Bremsen abwehrend, mit schnellem Antritt und hochgestrecktem Schwanz den Gipfel eines Hügels erstürmte, schnaufend innehielt und plötzlich, ehe ich mich versah, mit gesenktem Kopf herunterstürzte und an mir vorbei Reißaus nahm, die Bremsen hinter sich lassend, zwei Kühe folgten ihr stehenden Fußes. Ich war machtlos, weinte und musste die drei Kühe ziehen lassen. Rolf griff nicht in das Geschehen ein.
Читать дальше