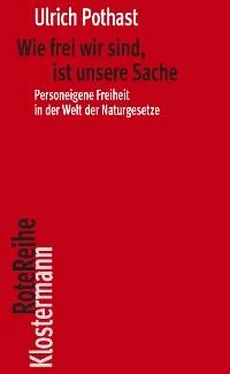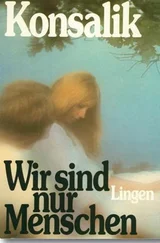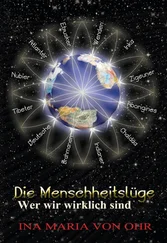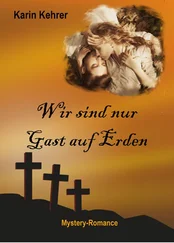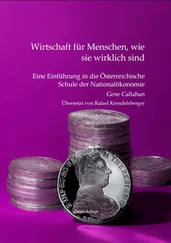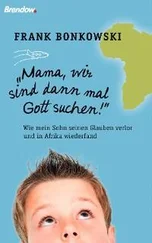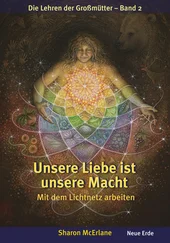Eine Merkwürdigkeit soll noch erwähnt werden: Während viele Autoren meinten und nicht mehr ganz so viele noch meinen, die Willensfreiheit komme den Menschen als fester, unverlierbarer Besitz zu, stimmen doch alle darin überein, dass etwa die politische Freiheit, die uns ebenfalls sehr wichtig ist, keineswegs als unverlierbarer Besitz betrachtet werden kann. Für die politische Freiheit scheinen alle einzusehen, dass ihr Erwerb Gegenstand leidenschaftlicher Kämpfe sein kann und oft gewesen ist, und dass diese Freiheit, wenn einmal etabliert, durch Wachsamkeit und tätige Anstrengung bewahrt werden muss. Es dürfte auch allgemein eingeräumt werden, dass politische Freiheit verlorengehen kann. Auch dürfte anerkannt sein, dass es eine Vielfalt von Weisen der inneren Aushöhlung politischer Freiheit gibt. Bei solcher Aushöhlung werden die bloßen Formen politisch freier Praxis nur noch als Rituale ausgeübt, während Freiheit in der Substanz schon aufgehört hat zu existieren. Dass vieles hiervon kraft elementarer Bedingungen menschlichen Lebens und Handelns auch für die unfeste, personeigene Freiheit gilt, die uns als selbstbewussten Individuen aufgegeben ist, erscheint deutlich. Die manifesten strukturellen Unterschiede, die zwischen politischer Freiheit und personeigener Freiheit auch bestehen, tangieren den Gedanken dieser Verwandtschaft nur am Rande. Historisch und bis heute war allerdings die verführerische Vorstellung einer durch pures Menschsein schon verbürgten, angeblich unverlierbaren, festen »menschlichen Freiheit« stärker. In der Geschichte westlichen Denkens seit der Spätantike wurde sie oft metaphysisch gedeutet und dann als quasi unantastbare Freiheit des Willens in herausgehobener theoretischer Rolle verwendet – zum Schaden der Glaubwürdigkeit großer Philosophien und daran anknüpfender Rechtssysteme.
3. Die Reichweite personeigener Freiheit hängt ab von unserem Willen. Unseren Willen bestimmen wir jedoch nie direkt. Wir können nur versuchen, ihn indirekt zu beeinflussen.
Es ist nach dem bislang Gesagten deutlich, dass personeigene Freiheit keine eingeborene, unverlierbare Eigenschaft des Menschen darstellt. Dass sie vielmehr in jedem Lebenslauf erworben und irgendwann auch wieder verloren wird, und dass ihre Ausdehnung oder Stärke sich in der Zeit verändern können. Erworben wird sie zunächst im Gang der Erziehung durch ein Zusammenwirken erziehender Maßnahmen und selbstbildender Bemühungen des Individuums. Beim Erwachsenen ist sie dann in entscheidendem Umfang der einzelnen Person anheimgestellt. Ihre Anstrengungen mit dem Ziel, eigenes Handeln in Einklang zu halten mit ihren übergreifenden Vorstellungen davon, wie dieses Handeln sein soll, entscheiden über Ausdehnung, Wachstum, Schrumpfen ihres personeigenen Freiheitsraums. Irgendwann auf dem Weg zum Tod hin, wenn die Kräfte so schwach geworden sind, dass die Person alle Kontrolle über sich verliert, geht auch diese Freiheit verloren – bei manchen Menschen früher, bei anderen erst mit dem letzten Atemzug.
Zur eingebürgerten Vorstellung vom Entstehen eigenen Handelns gehört, dass dieses Handeln in Verbindung mit einem Wollen erfolgt, kraft dessen es – manchmal sofort, manchmal mit zeitlichem Abstand – in Gang kommt. Äußerlich geschieht das durch Körperbewegungen einschließlich Bewegungen der Sprechorgane, innerlich (wenn man von innerem Handeln reden will) durch Lenken der Aufmerksamkeit. Unter dem Gesichtspunkt personeigener Freiheit erscheint dieses Verhältnis von Wollen und Tun zunächst unproblematisch: Wenn wir eine bestimmte Handlung wollen und nichts uns am Ausführen hindert, ablenkt usw., tun wir sie auch. In diesem Sinn baut die Ausübung personeigener Freiheit auf der Freiheit des Handelns auf, die uns unter Normalbedingungen gewöhnlich zukommt.
Ein Problem beim Verstehen personeigener Freiheit ist hingegen das konkrete Verhältnis zwischen der Person und ihrem Willen bzw. ihrem konkreten Wollen. Handeln wir einmal nicht so, wie wir es im Vorfeld beabsichtigt und für richtig befunden haben, dann hat sich im relevanten Zeitfenster unser handlungsauslösendes Wollen anders gebildet, als jene frühere Absicht es vorgab. Hier ist unsere personeigene Freiheit punktuell eingebrochen, denn wir haben in der konkreten Situation nicht so gewollt und gehandelt wie wir es zuvor entworfen haben. Das sehr wichtige Problem, das hier liegt, kann formuliert werden als die Frage: Wie nehmen wir Einfluss auf das Sich-Formieren unseres Wollens?
Diese Frage ist offensichtlich zentral für das Verständnis der Weise, wie wir uns das Leben mit personeigener Freiheit zu denken haben. Eine im Westen besonders machtvolle Antwort auf jene Frage lässt sich gleichsam in Reinkultur bei Vertretern der klassischen Willensfreiheit finden. Es ist die These, dass wir unseren Willen unmittelbar oder direkt bestimmen, ihn also ohne Umweg selbst lenken können. Einige Philosophen sagen auch oder implizieren, dass sich der vernünftige Wille kraft seiner Vernünftigkeit unmittelbar selbst lenkt. In besonderer Deutlichkeit finden wir den Gedanken der freien und unmittelbaren Willensbestimmung bei Immanuel Kant. Er übt in dieser Sache bis heute auf viele Philosophen, auch viele Juristen einen prägenden Einfluss aus. Kant bezeichnet in der Kritik der praktischen Vernunft eben diese Vernunft als »ein unmittelbar den Willen bestimmendes Vermögen«.1 Vielfach betont er bei seinen Erläuterungen zu der Frage, wie und auf welche Weise Vernunft praktisch (d. h. handlungswirksam) sein könne, die Unmittelbarkeit der Willensbestimmung durch eine solche Vernunft gemäß dem moralischen Gesetz. Dieses Gesetz gibt sich die vernünftige Person nach Kant in charakteristischer Autonomie selbst. Moderne Philosophen sprechen in Fragen der Willenslenkung zwar oft anders als Kant, folgen ihm aber häufig, indem sie an der Idee der unmittelbaren oder direkten Willensbestimmung durch Vernunftgründe festhalten.
Gegen die große Fülle dieser Auffassungen werde ich in diesem Buch die These vertreten, dass der Gedanke einer unmittelbaren oder direkten Lenkung unseres Wollens bzw. Willens auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. Diese Vorstellung vom Menschen als eines Wesens, das seinen Willen durch direkten Griff lenkt und bestimmt wie ein geistiger Steuermann, sollte aufgegeben werden. Ich werde versuchen zu zeigen, dass es den Bedingungen, unter denen wir als Menschen, d. h. als endliche, vielfach abhängige Wesen zu leben haben, besser entspricht, unseren Einfluss auf eigenes Wollen ganz anders zu deuten. Wir sollten diesen Einfluss so verstehen, dass wir uns dabei prinzipiell indirekt wirkender Mittel bedienen müssen und niemals sicher sein können, den angestrebten Erfolg auch zu erzielen . Mein Vorschlag ist, die Idee der unmittelbaren Willensbestimmung fallen zu lassen und statt dessen anzuerkennen, dass wir nur die Möglichkeit einer mittelbaren oder indirekten Willensorientierung haben. Zu ihr sind wir fähig, sie bleibt aber in Fragen ihres Erfolgs immer mit einem Rest von Ungewissheit behaftet. Die Deutung unseres Einflusses auf eigenes Wollen nach dem Modell der indirekten Willensorientierung bei stets unvollkommener Gewissheit erscheint mir nicht nur theoretisch überzeugender als das Vertrauen auf ein unmittelbares, sicheres Bestimmen unseres Willens. Diese Deutung bietet auch bessere Aussichten, uns gerade auf kritische Fälle und Lebenskrisen realistisch vorzubereiten. Gerade in solchen Krisen mündet der Glaube an direkte Willensbestimmung oft genug in Enttäuschung, hartnäckige Selbstvorwürfe und manchmal in hilflose Verzweiflung.
4. Über Titel und Aufbau des Buches
Dieses Buch geht aus von der Vorstellung des Menschen als eines Wesens, das durch vielfältige, oft unerkannte Einflüsse geworden ist, wie es ist. Seine Gegenwart, sein Denken, sein Werten und Handeln werden immer auch von unerkannten Faktoren mitbestimmt. Trotz aller Fremdeinflüsse kann dieses Wesen in Form seiner personeigenen Freiheit eine besondere Art von Selbst-Übereinstimmung erreichen. Diese Art der Übereinstimmung mit sich und der dringende, manchmal heftig gespürte Wunsch, sie zu bewahren, zu verteidigen, im negativen Fall wieder herzustellen, findet sich, soweit wir wissen, nur bei menschlichen Personen. Schon bei Heranwachsenden, erst recht dann im Erwachsenenalter sind Ausdehnung und Stabilität der personeigenen Freiheit zwar nicht vollständig, aber doch in hohem Maß von der Person selbst abhängig. Ihre Anstrengungen zur Orientierung ihres Willens an der eigenen Vorstellung, wie sie als handelnder Mensch sein möchte, liefern einen entscheidenden Beitrag dazu, dieser Mensch zu werden und in kritischen Lebenslagen zu bleiben. Daraus ergibt sich der Titel dieses Buches: Wie frei wir sind, ist unsere Sache .
Читать дальше