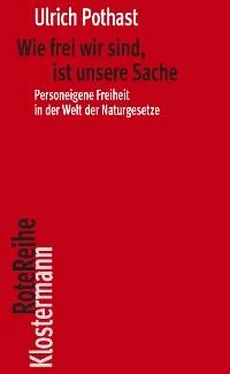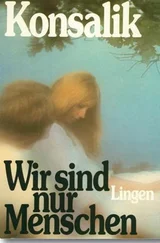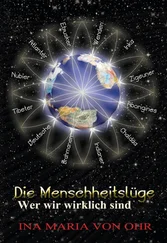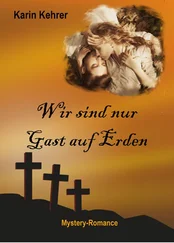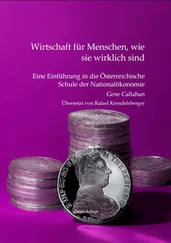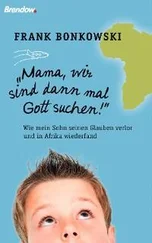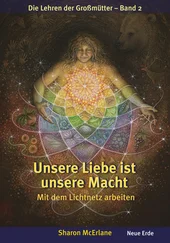Abstrakt mag ich mir übrigens in einer Entscheidungs- oder Handlungssituation sagen, dass es in meiner Persönlichkeit selbst sowie ihrer Verbindung mit vielen weiteren Faktoren ein für mich undurchdringliches Zusammenwirken von Einflussgrößen gibt. Ich kann mir auch sagen, dass daraus jede meiner Handlungen unausweichlich hervorgeht. Aber dieser Gedanke gibt mir für mein Entscheiden und Handeln in konkreten Lebenslagen keinerlei Leitung. Der Gedanke ist für meine Orientierung sogar irreführend. Denn es ist mir in der konkreten Situation selbst unmöglich, jenes Zusammenwirken von Einflussgrößen als Ganzes zu überschauen und schlüssige Voraussagen über mein Tun sicher daraus abzuleiten. Es ist mir gleichfalls unmöglich, fremde Voraussagen für meine Erkenntnis bindend zu übernehmen. Vielmehr muss ich in der aktuellen Lage, in der ich bin, mich selbst, meine ganze Person hier und jetzt, als die Instanz betrachten, aus der mein Entscheiden, mein Handeln oder Unterlassen hervorgehen. Dies ist unsere Situation unabtretbarer Wahl bei eigenem Entscheiden und Handeln. Aus ihr können wir durch keine Theorie, Wissenschaft oder Macht entlassen werden.
Daraus ergibt sich als Nebenresultat auch die Widerlegung des Fatalismus in Fragen menschlichen Handelns. Fatalismus ist die Meinung, was ich tun werde, liege immer schon im Voraus fest; es sei sinnlos, mich für das Finden der richtigen Entscheidung oder das Ausführen der rechten Tat anzustrengen. Denn über das eigene Tun sei ja schon immer im Voraus verfügt. Gewöhnlich berufen sich Fatalisten heute auf die (eigentlich ins 19. Jahrhundert gehörende) Idee eines universellen Determinismus für alle Ereignisse in der Welt mit der vermeintlichen Folgerung, alles, was geschieht, sei von Anfang der Welt an festgelegt. Der Fatalismus berücksichtigt nicht die besonderen Erkenntnisbedingungen eines jeden Menschen, der vor einer zu treffenden Entscheidung bzw. auszuführenden Handlung steht. Aus dem Gedanken eines universellen Determinismus folgt nämlich in keiner Weise, dass ich mit gutem Recht sagen könnte: »Wie ich mich entscheiden werde und was ich tun werde, liegt sowieso schon fest. Alle Anstrengung ist hier sinnlos.« Im Gegenteil: Wenn ich vor einer möglichen Handlung stehe und nichts mich offenkundig hindert oder zwingt, bin unter den für mich geltenden Erkenntnisbedingungen ich selbst die Instanz, von der die Richtung meines Handelns abhängt. In diesem Sinn bin ich in diesem Zeitfenster für meine Erkenntnis frei, jede der sich jetzt bietenden Handlungsalternativen zu wählen. Gegen manche Handlungen mag ich Widerstände haben, zu anderen mag ich mich hingezogen fühlen, vor vielem mag ich mich fürchten, einiges mag ich verabscheuen, bestimmte Handlungen, die mir schwer fallen, mag ich als meine Pflicht erkennen: Solange nichts mich erkennbar und unüberwindlich zwingt oder hindert, muss ich mich unter den Bedingungen meiner Erkenntnisperspektive jetzt und hier so verstehen, dass mir jede Handlungsrichtung offensteht, für die ich nicht manifest bestehende, unüberwindliche Hindernisse erkenne.
Natürlich erstreckt sich meine Sicherheit, jede Handlung ergreifen zu können, die mir nicht offensichtlich unmöglich ist, nicht darauf, dass ich das gewählte Tun auch erfolgreich zu Ende bringe. Eine Handlung hat stets eine zeitliche Ausdehnung, auch wenn sie als Tun eines bloßen Augenblicks erlebt wird. Innerhalb dieses Zeitfensters, und sei es noch so winzig, können immer unerwartete Hindernisse auftreten und das Zu-Ende-Kommen meiner Handlung unmöglich machen. Diese Hindernisse können überraschend von außen her kommen und meinen Handlungsversuch verzögern, in andere Richtung lenken, zum Stillstand bringen oder es sonst wie machen, dass ich meine gewählte Tat nicht vollende. Die Hindernisse können auch von meinem Körper, meiner Psyche oder beidem herrühren und mein Handeln unvoraussagbar beeinflussen, so dass es fehlgeht oder zum Stillstand kommt. Bekannt ist das Beispiel der Pianisten, denen ein bestimmter Finger plötzlich nicht »gehorcht«, so dass sie etwas anderes spielen als beabsichtigt. Und jeder kennt das Eigentor des Verteidigers beim Fußball, der sich hinterher vor Scham krümmt und nicht verstehen kann, wie ihm das passieren konnte.
Die Unmöglichkeit, vor eigenem Entscheiden, Handeln und natürlich auch vor der Ausbildung des zugehörigen Wollens das Gefüge der dabei kausal relevanten Faktoren zu überschauen, passt zu einer Erscheinung, die oft vernachlässigt wird: Wir können manchmal eigenes Entscheiden und das Sich-Geltendmachen entsprechenden Wollens im unmittelbaren Nachhinein erinnern als etwas, das auch für uns selbst überraschend eintrat. So ist es Hermann Weyl ergangen: Er fuhr zum Telegraphenamt in der Absicht, ein Telegramm mit der Annahme des Rufes aufzugeben. Stattdessen telegraphierte er eine Ablehnung, und zwar nicht aus Versehen, sondern aus eigener Initiative. Er hat uns nicht überliefert, wie kurz die Zeit war, die zwischen der Ausbildung des neuen Wollens und dem Niederschreiben der entsprechenden Worte auf dem Telegrammformular vergangen ist. Es könnte sein, dass er sich noch, während er schon beim Schreiben war, für ihn selbst überraschend um-entschied, weg vom Annehmen des Rufes und hin zum Ablehnen.
Handlungsrelevante kausale Verhältnisse stellen sich im Bewusstsein nur höchst unverlässlich dar, oder gar nicht. Das gilt vor allem für die Faktoren, die zu Wollen bzw. Entscheiden nur verdeckt beitragen, d. h. sich der suchenden Aufmerksamkeit nicht offen darbieten. Weyl hat sich in unabtretbarer Wahl gegen Göttingen entschieden; unversehens fand er sich als einen, der im Modus eigener Aktivität Göttingen ablehnte und Zürich bevorzugte. Aber wie dies alles zustande kam, kann er nicht im Einzelnen sagen. Trotzdem spricht er von der Entscheidung als seiner eigenen, er war es, der eine Ablehnung telegraphierte. Auch den äußeren Faktor des Treibens auf dem See erwähnt er als etwas, das es ihm angetan haben müsse.
Gewiss konnte Weyl das Sich-Ausbilden seines Wollens bzw. Entscheidens im fraglichen Zeitraum nicht von einer höheren Warte aus überschauen und lenken. Unser Wollen formiert sich, unser Denken, Fühlen, Wahrnehmen und vieles andere trägt dazu bei, aber wir übersehen diesen Gesamtprozess nicht wie höhere, dies alles kontrollierende Ingenieure. Und vor allem steuern wir das Sich-Bilden unseres Wollens nicht wie solche Ingenieure. Wir stehen, während sich unser Wollen formiert, nicht an einem über unserem Bewusstseinsleben angebrachten Regelpult und organisieren von dort das komplexe Zusammenwirken aller relevanten Zustandsgrößen. Wir können auch in das Sich-Ausbilden unseres Wollens nicht von einem solchen höheren Standpunkt her nach Maßgabe eines ebenfalls höheren eigenen Wollens gezielt und mit Ergebnis-Sicherheit eingreifen.
Zwar können wir unser Entscheiden und Tun im Prinzip nachträglich analysieren und oft daraus wichtige Einsichten gewinnen. Für die Analyse von Vergangenem bestehen nicht die gleichen, letztlich unlösbaren Erkenntnisprobleme, die für die Voraussage künftiger eigener Handlungen aus der Perspektive des tätigen Selbst bestehen. Jedoch sind wir von einer vollständigen kausalen Analyse vergangener Wollensbildung und vergangenen Entscheidens extrem weit entfernt. Wenn wir eine Entscheidung gut vorbereitet haben, können wir oft eine schlüssige Begründung dafür liefern, und diese Begründung mag auch unsere wirklichen Gründe darstellen, soweit uns bekannt. Wir können sogar oft etwas benennen, das bei einer Entscheidung nach unserer Meinung »den Ausschlag gab«. Dies ist schon sehr viel, aber gewiss nicht alles. Auch im Nachhinein ist uns eine vollständige Übersicht über die Gesamtkonstellation kausal beteiligter Faktoren nicht zugänglich.1
Читать дальше