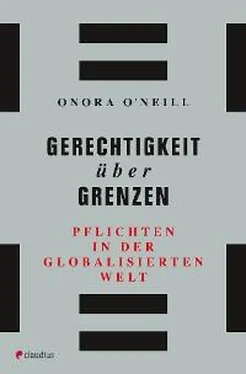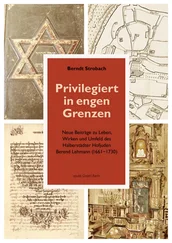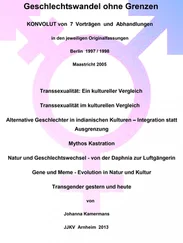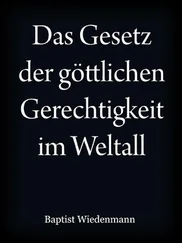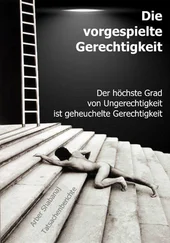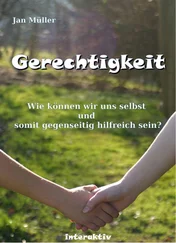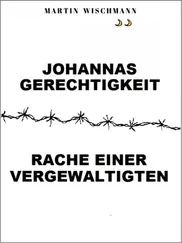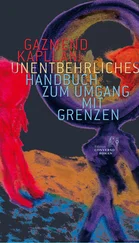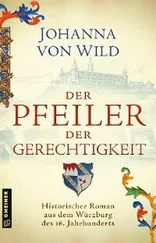Die Entschädigung ist ein weiterer, eigenständiger Ansatz, vergangenes Fehlverhalten und den dadurch entstandenen Schaden auszugleichen. Sie bezieht sich weder auf moralische Beziehungen noch auf die Täter, sondern einzig auf die Geschädigten. Es handelt sich dabei um eine ganz eigene Form rektifikatorischer Gerechtigkeit, denn sie muss in einer Hinsicht Stellvertretern offenstehen und kann dies in einer anderen.
Opfer erhalten eine Entschädigung, wenn jemand ihnen einen äquivalenten , aber nicht identischen Ersatz ( stellvertretend ) für ihren Verlust oder Schaden anbietet. Und das Äquivalent selbst kann stellvertretend angeboten werden, zum Beispiel von Menschen, die für den Verlust oder Schaden nicht verantwortlich sind (Steuerzahler späterer Generationen). Entschädigung unterscheidet sich von der Restauration darin, dass sie nicht zurückgibt, was das Opfer verloren hat: Jemand, der ein gekidnapptes Kind seinen Eltern zurückgibt oder ein gestohlenes Auto seinem Eigentümer, leistet keine Entschädigung, sondern eine (möglicherweise nicht vollständige) Wiederherstellung. Entschädigung unterscheidet sich auch von der Strafe. Die Strafe versucht, Fehlverhalten zu bereinigen, indem sie sich auf die Täter konzentriert. Die Opfer finden dabei meist weniger Beachtung, genauso wenig wie die Beziehung zwischen Opfer und Täter.
Diese kurzen Anmerkungen zu Wiederherstellung, Strafe und Entschädigung zeigen nicht nur, dass es sich dabei um unterschiedliche Korrektive handelt, sondern auch, dass jedes in einem umfassenden Bild der rektifikatorischen Gerechtigkeit seinen ganz eigenen Platz hat. Denn deren Ziel muss es sein, Überlegungen anzustellen, was nötig ist, um die vormaligen Beziehungen zwischen Tätern und Opfern wiederherzustellen, und daneben aufzeigen, was mit den Tätern und mit den Opfern geschehen soll. Führen wir jedoch unsere Überlegungen weiter, dann gelangen wir zu der Erkenntnis, dass eine adäquate Wiederherstellung sowohl der Strafe als auch der Entschädigung zuvorkommt. Sobald eine Fehlhandlung sozusagen gelöscht ist, gibt es nichts zu strafen und nichts zu entschädigen. Adäquate Wiederherstellung mag in der faktischen Wiederherstellung dessen bestehen, was unrechtmäßig genommen wurde. Oder in einer symbolischen Rückgabe und einer symbolischen Bestrafung, die darauf abzielt, für etwas „Wiedergutmachung“ zu leisten. Wenn es zur Wiederherstellung kommt, ist dies keine Entschädigung. Hier wird kein materielles Äquivalent übereignet. Außerdem kann die Wiederherstellung nicht von irgendjemandem geleistet werden. Sie ist vielmehr ein symbolisches Angebot vom Täter an das Opfer (bzw. ihre jeweiligen wechselseitig anerkannten Nachfolger), das die frühere Beziehung wiederherstellen soll. Daher wird durch diesen Akt sowohl die Entschädigung als auch die Strafe überflüssig, beides würde sogar beleidigend wirken.
Angebote zur Entschädigung sind daher unabhängig von Vorschlägen, jene zu bestrafen, die andere diskriminiert oder ihre Rechte in anderer Form verletzt haben. Die Täter könnten ja schließlich schon lange tot oder schlichtweg unbekannt sein. Die Opfer von Unglücksfällen oder Verbrechen können ja auch entschädigt werden, wenn niemand weiß, wer für die Taten ursächlich verantwortlich ist, was bedeutet, dass auch niemand bestraft werden kann.
Diese allgemeinen Ausführungen sagen nichts aus über das Recht auf Entschädigung, das Gegenstand einiger Diskussionen ist. So haben zum Beispiel viele der Laissez-faire-Liberalen Bedenken, was das Recht auf Entschädigung angeht, außer im Falle von Verstößen, bei denen die Verantwortlichen klar identifiziert und für Entschädigungsleistungen an die Opfer herangezogen werden können. Vor diesem Hintergrund ist das Recht auf Entschädigung symmetrisch zum Recht auf Strafe. Und jede gerechtfertigte Entschädigung erfordert eine Partei, die den Schaden verursacht hat, und eine, die ihn erlitten hat. Die Wohlfahrts- oder Sozialliberalen wiederum sind zwar damit einverstanden, dass bei Rechtsverletzungen eine Entschädigung fällig wird. Doch sie lehnen den Gedanken ab, dass die Verpflichtung zur Entschädigung nur jene trifft, die für den speziellen Schaden verantwortlich sind. Rechteverletzungen, die durch bestimmte soziale Praktiken geschehen, begründen in ihren Augen das Recht auf Entschädigung, selbst in Fällen, wo es schwierig oder unmöglich ist, die Täter zu identifizieren.
Strafe und Entschädigung bei Locke und Nozick
Diese Unterscheidungen bieten uns einen Rahmen, vor dem wir Nozicks Anspruch auf Entschädigungsrechte in den ersten Kapiteln von Anarchie, Staat, Utopia behandeln können. Obwohl Nozick sein Unterfangen in die Nachfolge Lockes stellt, unterscheidet es sich doch sowohl im Ausgangspunkt als auch in der Argumentation erheblich von Lockes Traktat Über die Regierung . 33Lockes begrifflicher Rahmen ist ein theologischer: Er sieht die Menschen als grundlegend frei, nur dem Naturrecht und den unter Menschen getroffenen Absprachen unterworfen. Die Grundlage der Moral bilden bei ihm die menschlichen Pflichten, nicht die Menschenrechte. Er argumentiert, dass der Mensch dem Naturrecht nur unvollkommen gehorcht und der einzig gerechte Weg, dessen Einhaltung zu verbessern, ein System der Durchsetzung ist, das nachvollziehbar sein muss. Läge nun die Bestrafung in den Händen Einzelner, wären die Resultate eben ungerecht und willkürlich. Die Durchsetzung des Naturrechts durch Strafe muss also auf die Gesellschaft übertragen werden. Die politische Ordnung ist gerechtfertigt als bester Weg, das Naturrecht umzusetzen. Lockes Bild beruht zentral auf der Freiheit des Menschen und auf seinen Pflichten. Er sieht ihn nicht als Träger von Rechten, die Ansprüche darauf begründen, was getan oder unterlassen werden sollte. In seiner Perspektive sind die Menschen Akteure, nicht ihrem Schicksal Unterworfene. Es geht ihm zuallererst darum, die Ausführung von Pflichten sicherzustellen, nicht um die Rechte, die beachtet werden, falls die Pflichten erfüllt werden. Der Gedanke der Entschädigung ist für ihn nebensächlich.
Wo Locke sich mit Fehlverhalten aus der Perspektive des Opfers auseinandersetzt, spricht er nicht von Entschädigung, sondern von Wiedergutmachung. Er geht davon aus, dass (anders als das Recht zu strafen) das Recht auf Wiedergutmachung nur dem „Geschädigten“ zukommt. Es gesteht diesem zu, von dem Übeltäter „so viel wiederzuerlangen, wie es der Wiedergutmachung für den erlittenen Schaden dient.“ 34Dieses Recht auf Wiedergutmachung ist ein Recht auf das Äquivalent des Schadens, nicht auf das Äquivalent des Verstoßes. Locke geht nicht davon aus, dass es ein allgemeines Maß moralischer Werte geben kann. Er nimmt vielmehr viel bescheidener an, dass es eine Reihe von Verstößen gibt, bei denen sich der verursachte Schaden – nicht der Verstoß selbst – ausgleichen lässt, indem man ein Äquivalent zur Verfügung stellt.
Zwischen der begrenzten Rolle, die Locke der Entschädigung zuweist, und der zentralen Rolle, die sie bei Nozick annimmt, liegen Welten. In Nozicks Augen kann eine Entschädigung nicht nur für den Schaden geleistet werden, den man zugefügt hat, sondern unter bestimmten Umständen auch für das Fehlverhalten selbst, d. h. für Handlungen , die Rechte verletzt haben. Eben dieser Punkt ist Grundlage seiner Aussage, dass bestimmte Rechteverletzungen erlaubt sind, falls es dafür Entschädigung gibt . Überraschenderweise bleibt er nicht auf dem Standpunkt, dass Handlungen, die Rechte verletzt haben, verboten sind und Handlungen, die das nicht tun, erlaubt. Stattdessen stellt er die Frage, was mit risikobehafteten Handlungen passiert, die jemandes Rechte verletzen könnten . Und wie geht man mit privater Durchsetzung der Gerechtigkeit um? Er stimmt Locke zu, dass eine solche riskant wäre und vermutlich Rechte verletzen würde. Dann aber argumentiert er, dass riskante Strafaktionen nur dann verboten werden könnten, wenn eine Entschädigung für diese Einschränkung der Freiheitsrechte vorgesehen ist. 35Ein sich herausbildender Staat könne legitim das Gewaltmonopol für sich beanspruchen, indem er riskante Maßnahmen privater Justizausübung verbiete, wenn er jene entschädige, deren (angenommenes) Recht zu strafen er damit verletze. Dieses Argument wurde vielfach kritisiert: Ich aber möchte mich hier auf einen dieser Kritikpunkte beschränken.
Читать дальше