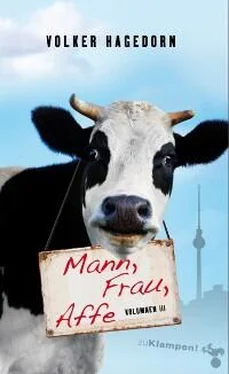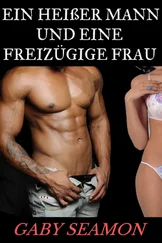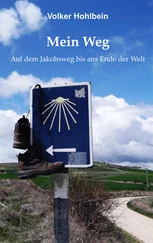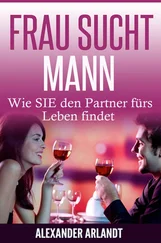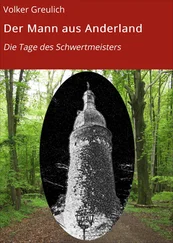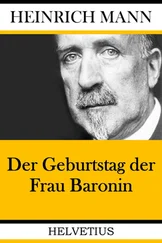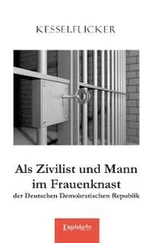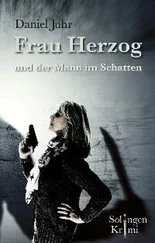»Sorry. Ihre Lesezeit ist leider abgelaufen«, sagte ich und wand ihm das Heft aus den Händen. Unphilosophisches Kreischen erfüllte den Lesesaal. Beim nächsten Mal war er schneller als ich und hielt sich ans Regal daneben, Romanautoren mit »Sch«. Der Schutzumschlag von »Der stille Don« war genauso schnell zerfetzt, wie der alten Taschenbuchausgabe von »Casanovas Heimkehr« die Frontpappe fehlte. »Nein! Nein! Nicht auch noch die ›Gelehrtenrepublik‹! Komm, ich les dir daraus vor. ›Auf Kankerstelzen aus Licht der kleingeschnürte Sonnenleib‹ …« Er schrie. Arno Schmidt ist noch nichts für ihn.
Dafür lässt er sich von seiner Mutter mit bemerkenswerter Geduld »Clara und Paul« vorlesen, wobei sie ihm untersagt, an dem Buch zu nagen. Wir sind da unterschiedlicher Meinung. »An einem Bilderbuch mit dicken Pappseiten kann er doch mal nagen«, sage ich. »Dann macht er das bei deinen Büchern auch«, sagt sie, »oder kannst du ihm den Unterschied erklären?« »Hehe!« Das Kerlchen lachte. Ich muss das mit der literarischen Früherziehung nochmal überdenken.
Briefmarken von der Rolle, 100 Stück zu je 55 Cent. »Was ist es eigentlich für ein Motiv?« »Der arme Poet«, sagte die Postangestellte. »Achje, ich nehme doch lieber was anderes. Es muss auch nicht von der Rolle sein.« Ich habe dieses Bild noch nie gemocht. Und die Vorstellung, dauernd diesen armen Poeten auf meine Briefe zu kleben, behagte mir auch nicht. Dem Mann, den Spitzweg in einer süßlichen Mischung aus Karikatur und Idyll vorführt, geht es doch eigentlich sauschlecht unter dem Schirm, der ihn vor Wasser aus dem undichten Dach schützen soll. Was würde es signalisieren, wenn ich meine Rechnungen mit diesem Jammerbild beklebte? Dass ich mehr Honorar brauche?
Von wegen. Dieses Bild signalisiert ja tiefstes Einverständnis mit der bürgerlichen Vorstellung von selbstverschuldet brotloser Kunst: »Was muss der Mann auch Gedichte schreiben, das hat er nun davon, und wahrscheinlich sind sie eh alle so schlecht wie die, die er schon in den Ofen links im Bild gesteckt hat, um damit die klamme Bude zu heizen.« Ich bin kein Poet, mag aber Gedichte, bewundere die, die sowas hinkriegen, egal ob im Liegen oder im Stehen, und irgendwie beleidigt Spitzweg die ganze lyrische Zunft.
Angeblich ist sein Bild ein ironischer Gegenentwurf zu Caspar David Friedrichs »Wanderer über dem Nebelmeer«, wo man einen gut gekleideten Einzelgänger von hinten sieht, der gewaltigen Natur gegenüber. Bei Spitzweg, las ich in einer Exegese, sei hingegen die Natur der Floh, den der Poet gerade zwischen den Fingern zerdrückt. Auweia.
Leider gab es den Wanderer nicht als Briefmarke, ich nahm stattdessen eine Kollektion von Leuchttürmen, da macht man nichts falsch, außerdem noch zehn Mal Franz Kafka. Seine Zeichnung von dem Typen, der erschöpft überm Tisch zusammengebrochen ist, vermittelt auch in der Korrespondenz mit Redaktionen das richtige Signal auf hohem Niveau.
Zu Hause ging ich zum Rauchen auf den Balkon. Es regnete, und ich holte einen Schirm. Da stand ich dann, höhenmäßig etwa dem Wanderer über dem Nebelmeer vergleichbar, unter einem Schirm, der an Spitzweg erinnerte. Das wäre doch das passende Bild für unsere Zeit, dachte ich. Weltweit stehen die Schreiber, egal ob Poeten oder Prosaisten oder Kolumnisten oder Kafkaisten, auf ihren Balkons, weil sie, voller Einsicht und guten Willens, an ihren Schreibtischen nicht mehr rauchen. Heroisch klappen sie im Regen die Schirme auf. Verschwunden sind Flöhe und Nebelmeere, der Schirm aber wird geadelt zum Insignium des Konflikts zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischem kreativem Rauchen und sozialem Nichtrauchen.
Kann das mal jemand malen? Das würde ich gleich von der Rolle kaufen.
Im Schatten eines Doppelturms
Ab und zu mache ich auf dem Balkon Fotos von Sonnenuntergängen. Die sehen so aus, als befände man sich in wilder Natur: Am unteren Rand Baumwipfel, ansonsten dramatische Wolken, rot, orange, rosa, violett, diverse Blaus. Es könnte sonstwo sein, Canada etwa, oder Australien. Ich muss dafür nichts wegpixeln. Ich muss nur warten, bis die Sonne überhaupt mal zum Vorschein kommt und Berlin nicht unter der ortstypischen Wolkendecke begraben liegt. Und vor allem darf ich die Kamera nicht zu weit nach links bewegen. Da steht nämlich der Spukturm.
Der Spukturm ist eigentlich ein Doppelturm, er besteht aus zwei zusammengeklebten Hochhäusern der 70er Jahre. Die Berliner nennen das Ding »Kreisel«. Sie haben hier seltsame Bezeichnungen. Die höchste Bodenwelle der Stadt, ein Trümmerberg, heißt »Insulaner«. Hannoveraner sind da anders. Wenn sie in eine Masch einen See graben, heißt er Maschsee und nicht Bergziege, ein Hochhaus heißt Hochhaus, in begründeten Einzelfällen auch Anzeiger-Hochhaus, aber nicht Gurke oder Auster. Als gelernter Hannoveraner kann ich in Berlin auch rings um den Spukturm keinen Kreisel erkennen, dafür aber die weltweit komplizierteste Art, das Ende einer Autobahn mit zwei Straßen zu verknoten.
Grob geschätzt 163 Ampeln regeln den zähen Verkehr auf zahllosen Teilabschnitten. Es ist unmöglich, dieses Labyrinth ohne anzuhalten zu überqueren, sogar ein Selbstmordattentäter unter Zeitdruck würde hier unwillkürlich bei Rot warten. Umwürgt von diesem Netz erhebt sich also das »Kreisel« genannte Monument, auf das mein Balkon eine fabelhafte Sicht bietet. Der Doppelturm ist völlig leer und nachts zappenduster bis auf rote Lämpchen an den Kanten zur Orientierung der Flugzeuge, die bis vor Kurzem nach Tempelhof flogen (noch so ein irrer Name! Als wäre da mal die Akropolis gewesen und nicht ein preußischer Exerzierplatz).
Wegen einer Asbestverseuchung, deren Beseitigung fast 100 Millionen Euro kosten würde, darf in den Turm niemand hinein, fast niemand. Ein Architekt, der drin war, hat mir erzählt, man habe von oben eine berauschende Sicht bis hin zum Insulaner und nach Tempelhof und wohl noch weiter. Eine Berlinerin, die nicht drin war, reagierte indigniert auf meine Bemerkung, der Turm verstelle mir die Sicht nach Südosten. Ich sei hier schließlich in einer Großstadt. Mein toter Lieblingsnachbar hätte dem Spukturm und auch dem irren Labyrinth womöglich etwas abgewonnen. Aber Franz Kafka gefiel der Rathausplatz, wie die Ecke damals hieß, auch so.
Auf meinen Abendfotos existiert der Spukturm jedenfalls nicht. Die Leute, denen ich sie zeige, fühlen sich von den Sonnenuntergängen über Baumwipfeln allerdings nicht an Australien oder Canada erinnert. Manche sagen, es sähe aus wie über den Feldern und Wäldern nördlich von Hannover.
Neulich bin ich mal wieder in meiner Lieblingsgegend spazierengegangen, nördlich von Hannover, in den Feldern ums Dorf, in der Dämmerung. Außer mir war nur noch ein Trecker unterwegs, ich wusste auf einmal nicht mehr, wie man Stress buchstabiert. Und dann waren da die Kühe. Zehn Kühe standen hinterm Zaun in einer Reihe unter Bäumen. »Guten Abend«, sagte ich, und weil mir das etwas zu wenig schien für so viele, fügte ich an: »Na, ihr?« Es ist nicht leicht, bei Kühen den richtigen Ton zu treffen, aber sie fanden es wohl okay. Gemeinsam sahen sie mir nach, während ich vorbeispazierte.
Und diese Stille! Wenn ich jetzt auf den Balkon trete, höre ich Autos brausen und sehe hunderte von Menschen, Straßen, Häuser und Hochhäuser, ein paar Bäume auch, aber hinter denen ist die Stadt noch lange nicht zu Ende. Es ist in Berlin nicht einfach, sich vorzustellen, wie es wohl war, als hier nur ein paar Dörfer in der Landschaft standen. Aus dieser Zeit ist in meinem Stadtteil ein Straßenname geblieben, »Frohnhofstraße«, da muss es einen Hof gegeben haben. Die Straße ist eine Asphaltschlucht, eingeklemmt zwischen S-Bahn-Damm und den Spukturm, dessen obere Etagen bei Nebel verschwinden.
Читать дальше