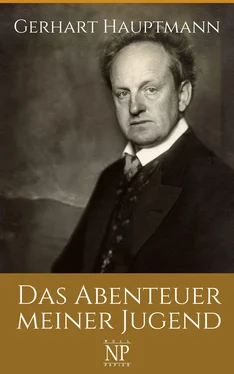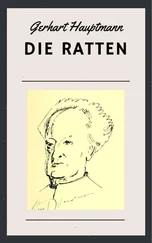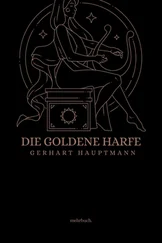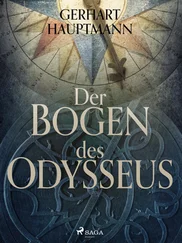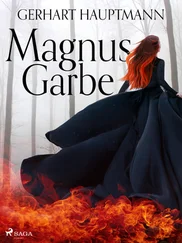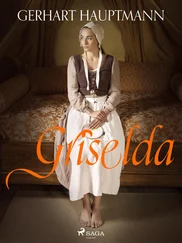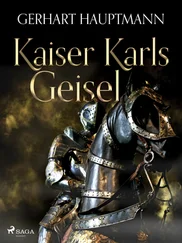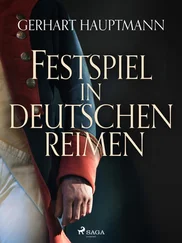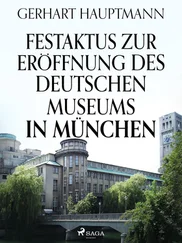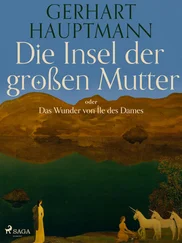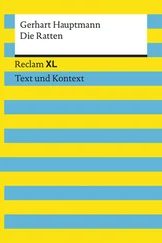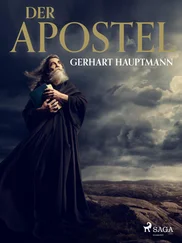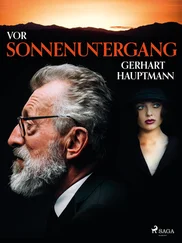In der Familie entstand eine üppige Legendenbildung über die unerschrockenen und sieghaften Rückeroberungszüge meines Bruders Carl, die besonders von Johanna gepflegt wurde, aber auch meines Vaters, ich glaube befriedigtes, Ohr gewann.
Meine Mutter war gar nicht kriegerisch, sie sah von dem allem nur die Kehrseite. »Weshalb«, sagte sie, »binden wir mit den Enkes an?« – Es waren unsere nächsten Nachbarn im Haus Elisenhof auf dem Kronenberg. – »Wir haben sie so schon oft genug auf dem Halse. Der Säufer Rudolf, mit dem sich Carl wegen einer lumpigen Taube gezankt hat, vergisst eine Kränkung nicht. Carl soll sich in acht nehmen, dass nicht die Leute vom Deutschen Haus ihm einmal im Dunkel übel mitspielen! Der Bauer Demuth hat gesagt: Ihr Junge nimmt den Mund sehr voll« – sein Gutshof war vom Gasthof zur Krone nur durch die Straße getrennt –, »Ihr Junge nimmt den Mund sehr voll, wir haben nicht nötig, Tauben zu stehlen!«
Die Tauben Carls machten große Aus- und Umflüge, denen wir gern mit den Augen nachfolgten, und nicht nur das, sondern auch mit den Füßen bei der erwähnten Suche nach Flüchtlingen. Einen weiteren Umkreis des Dorfes Salzbrunn genauer kennenzulernen, war das die beste Gelegenheit. So gerieten wir nach Adelsbach, nach dem nahen Konradstal, in dieses und jenes der Weißsteiner Bauerngüter, gerieten nach dem Ausflugsort Wilhelmshöh, ja einmal bis in den sogenannten Zips, ein liebliches Tal, das in den Fürstensteiner Grund mündete. In diesen Grund blickte von seiner felsichten Höhe das Schloss Fürstenstein, wo zuweilen der Fürst residierte, dem das Bad Salzbrunn gehörte und von dem so viel als dem Fürsten schlechthin die Rede war.
*
Wenn das Taubeninteresse mich mit Carl in Berührung brachte, eine Spielgemeinschaft hatten wir nicht. Er besaß seinen eigenen Jungenskreis, und ich weiß nicht, was sie gemeinsam trieben. Dass es Spiele waren, wie ich sie liebte, glaube ich nicht. Wir haben uns, scheint mir, instinktiv voneinander ferngehalten, wobei allerdings der Unterschied im Alter, es waren vier Jahre, was in der Jugend viel bedeutet, mitgesprochen hat.
Schenken, nicht empfangen, war Carls höchster Genuss. Es mochte dabei schon damals ein Werben um Menschenseelen mitspielen. Mutter bekämpfte gelegentlich seine Freigebigkeit, aber er hatte eine schöne, eigenwillig moralische Art, abzuwehren. Er machte auf alle, die ihn hörten, auch Vater und Mutter, Eindruck damit.
Sehr weit in meine Jugend zurückgehen müssen seine Tiraden gegen den Eigennutz, die er nach kaum vollendetem zehnten Jahr im Gespräch mit den frommen Tanten im Dachrödenshof, sogar gegen die kirchliche Lehre von der Belohnung des gläubigen Christen durch die ewige Seligkeit, mutig ins Feld führte. Er sagte, wer Gott nur wegen einer zu erwartenden Belohnung liebe, der sei noch nicht anders als ein Hund, der die Zuckerdose anbete. So jung ich war, stand ich bei solchen Behauptungen hinter ihm.
Er war im Allgemeinen leicht aufgeregt, meist aber, ähnlich einem gewissen spanischen Ritter, aus Rechtsgefühl und aus Mitgefühl.
Tierquälerei riss ihn zu rücksichtslosen Protesten hin, bei denen er vor den rüdesten Bauernknechten nicht zurückschreckte.
*
Es mochte im Jahre 68 sein, als auf einmal Georg Schubert, der Sohn meiner Tante Julie und des Oberamtmanns Schubert, in meinem Bewusstsein vorhanden war. Man erfuhr und besprach jede Kleinigkeit aus dem Entwicklungsgange des damals Dreijährigen. Die Gespräche der gesamten Verwandtschaft kreisten um ihn, der, in einer kinderlosen Ehe sehnlichst erwartet, endlich erschienen war.
Aus der Ehe des Brunneninspektors Straehler waren sieben Kinder, vier Töchter und drei Söhne, hervorgegangen. Unter den Töchtern war meine Mutter die Zweitälteste, Tante Julie das zweitjüngste Kind. Ich muss heute sagen, sie hatte mit ihren Geschwistern wenig Ähnlichkeit.
Sie war außergewöhnlich begabt als Schauspielerin, Pianistin und Sängerin, Fähigkeiten, die sie beruflich nie ausübte. Nachdem sich eine Verbindung mit einem jungen Kavalier angebahnt und zerschlagen hatte, gab sie auch auf Drängen der Eltern der Werbung des Oberamtmanns Gehör, eines äußerst gediegenen Mannes, der aber sonst, Sohn eines Schullehrers, nicht grad ein glanzvolles Äußeres aufweisen konnte.
Tante Julie machte bald auf dem Rittergut Lohnig, das Schubert gepachtet hatte, ein großes Haus. Sie umgab sich mit den besten Elementen des schlesischen Landadels und der Geistlichkeit. Die von ihr auf dem Grunde einer Resignation aufgebaute Ehe konnte kaum glücklich genannt werden, bevor der Sohn geboren war, und die junge, mit gesellschaftlichen Talenten, durch Kunst und Geist ausgestattete Frau hat wohl in der Pflege ihrer Gaben Ersatz gesucht.
Nun aber hatte sich in Gestalt des kleinen Georg der Segen Gottes, das Glück in seiner höchsten Fülle auf die Schuberts, zur unendlichen Freude des Großvaters Straehler und seiner Kinder, herniedergesenkt.
Die glückliche Mutter, Tante Julchen, kam gelegentlich mit Georg zu Besuch in den Dachrödenshof und tat dann auch mit ihm die zwei Schritte bis zum Gasthof zur Preußischen Krone. Der Kleine war wirklich ein Wunderkind. Vierjährig löste er mathematische Aufgaben. Bruder Carl, der, zehn- oder elfjährig, schon eine gewisse Frühreife zeigte, prüfte ihn und lobte ihn so, dass ich im Stillen an mir selbst und meinen Anlagen verzweifelte.
Der Liebling aller war aber in der Tat ein liebenswertes und herzensgutes Kind. Alle Welt beeiferte sich, an Wünschen zu erfüllen, was man ihm nur an den Augen absehen konnte. Um auf das Dach zu den Tauben zu steigen, war er noch zu klein, und man hätte ihn auch im späteren Alter einer solchen Gefahr unter keinen Umständen ausgesetzt. Von den Fenstern gewisser Zimmer der Krone, ja schon von den Fensterbrettern wurde er aus Furcht, er könne abstürzen, ferngehalten. Carl zeigte dem Kleinen seine Lachtauben, seine milchweißen Pfauentauben, die äußerst zahm waren, zeigte ihm Stahlstiche aus des Vaters Bücherschrank, alles, um sich an der Art seines Eingehens zu entzücken. Im Alter stand er Carl ferner als ich, weshalb er sich auf eine ungezwungenere Art und Weise mir anschließen konnte.
Mein Großvater hatte auch den Warschauer Hof, einen zum Bade gehörigen Gutsbetrieb, unter sich. In weiten Stallungen wurden hier, wegen der Eselinnenmilch zu Kurzwecken, Esel gehalten. Man hatte allmorgendlich Gelegenheit, sich an der Herde schöner Tiere zu erfreuen, wenn man sie auf die Weide trieb. Sie wurden auch zum Reiten benutzt. Alte, schwere Damen, Kranke, die nicht gut zu Fuß waren, aber auch übermütige Gesellschaften lebenslustiger junger Herren und Damen ließen sich nach der Schweizerei oder nach Wilhelmshöh hinauftragen. Es war keine kleine Angelegenheit, als der hochmögende fürstliche Brunneninspektor einen solchen Esel als Geburtstagsgeschenk für seinen geliebten Enkel Georg nach Rittergut Lohnig schickte.
Читать дальше