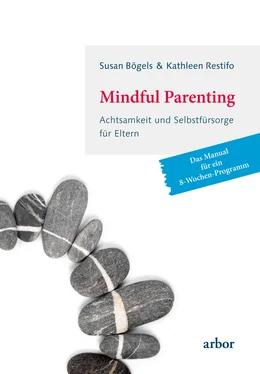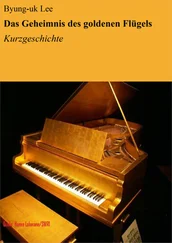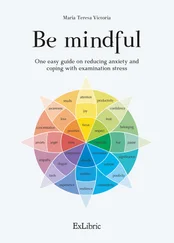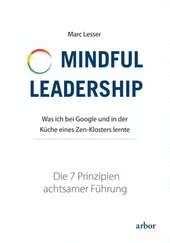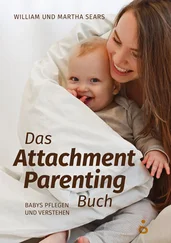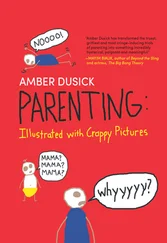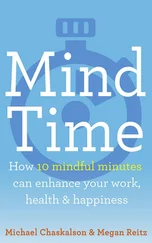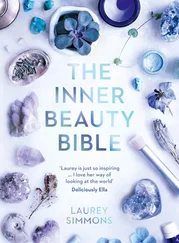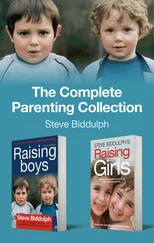1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Bei Spezies, die in kooperativer Aufzucht für ihre Jungen sorgen, sind nicht nur die Mütter, sondern auch andere Individuen, sogenannte Allomütter , zu denen Väter, Großeltern, ältere Geschwister und Tanten, aber auch nicht mit der Mutter verwandte Mitglieder der Gemeinschaft gerechnet werden können, in die Kinderbetreuung und -versorgung involviert. Obwohl diese Form der Aufzucht schon für viele andere Spezies von Bienen bis hin zu einigen Hunde- und Primatenspezies beschrieben wurde, haben Evolutionstheoretiker erst vor Kurzem ihre Bedeutung für die menschliche Evolution erkannt. Die Befunde der Evolutionsforschung lassen darauf schließen, dass Mütter während der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte bei der Aufzucht ihrer Kinder von vielen anderen Pflegepersonen unterstützt wurden (Hrdy 2009; Konner 2010). Die in der westlichen Kultur gehegte Erwartung, dass sich Mütter exklusiv und ohne Inanspruchnahme anderer Personen um ihre Säuglinge und Kleinkinder zu kümmern hätten, passt einfach nicht zur Geschichte der menschlichen Evolution und Anpassung.
2.2.2.1 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive ist die Kernfamilie eher eine Abweichung als eine „naturgegebene“ Regel. Sarah Hrdy zufolge entstand das Ideal der Kernfamilie in den 1950er Jahren und sah vor, dass ein Elternteil arbeiten ging und die Familie ernährte, während der andere sich ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmerte, was nur während des Wirtschaftsbooms der Nachkriegszeit möglich war. So gesehen ist die Kernfamilie also kaum ein Wimpernschlag in der langen Geschichte der Menschheit (Hrdy 2009). Doch gerade der gehobene Lebensstandard, den die westlichen Industrienationen heute genießen, fordert einen hohen Preis von den Müttern: Denn nun lastet eine Aufgabe, die früher von vielen nah verwandten, vertrauten und hoch motivierten Pflegepersonen wie Großmüttern, Tanten und Cousinen gemeinsam bewältigt wurde, fast ganz auf den Schultern der Mütter (und in manchen Fällen der Väter). Obwohl die meisten westlichen Frauen heute so frei wie nie zuvor in der Geschichte über die Anzahl und den Zeitpunkt ihrer Schwangerschaften bestimmen können, folgen diese nicht selten in viel kürzeren Abständen aufeinander als bei unseren Ahninnen im Pleistozän. Wenn man berücksichtigt, dass die meisten Mütter und Väter in industrialisierten Gesellschaften außer Haus arbeiten und dass es an guten und bezahlbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten mangelt, überrascht es nicht mehr, dass viele Eltern unter Stress leiden. Einfach ausgedrückt: Verglichen mit unseren Jäger-Sammler-Vorfahren tragen wir bei der Aufzucht unserer Kinder eine größere Last (unsere Kinder folgen dichter aufeinander), verfügen aber über geringere Ressourcen (wir bekommen weniger Unterstützung von anderen Pflegepersonen, sind sozial relativ isoliert und haben wegen unserer beruflichen Verpflichtungen weniger Zeit für unsere Kinder). Auch wenn wir unsere Vorfahren bei einem Modewettbewerb in den Schatten stellen dürften: Wenn es um die Qualität des Elternalltags geht, tragen sie klar den Sieg davon.
2.2.2.2 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Aus der menschlichen Evolutionsgeschichte können wir lernen, dass wir schon immer ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen des Elternseins und der Fürsorge für uns selbst herstellen mussten, und dass wir nur dann für unsere Kinder sorgen können, wenn uns genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um für uns und für sie zu sorgen. Auch wenn Eltern genug Geld haben, um ihre Kinder zu ernähren, kann es schwierig und mühsam sein, die Bedürfnisse der Kinder und der Familie mit beruflichen Anforderungen zu vereinbaren. Wenn die mit dem Elternsein verbundenen körperlichen und emotionalen Beanspruchungen unsere Belastungsgrenze überschreiten, fühlen wir uns vielleicht gestresst, erschöpft und unzulänglich, sind deprimiert oder sehr selbstkritisch. In unserer modernen westlichen Gesellschaft gilt es als erstrebenswert, sein Möglichstes zu tun, und das Akzeptieren der eigenen Grenzen wird oft als Schwäche angesehen. Doch in unserer evolutionären Geschichte hatten Kinder bessere Überlebenschancen, wenn ihre Eltern über genügend Ressourcen zu ihrer Aufzucht verfügten, und dazu zählte die Unterstützung anderer (Hrdy 2009).
In der ersten Sitzung eines Mindful-Parenting-Kurses laden wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich der mit dem Elternsein verbundenen Stressbelastungen, wie sie sie in ihrem Körper, ihren Gedanken und Gefühlen erleben, bewusst zu werden. Wir gestehen uns ein, dass es sehr anstrengend ist, Vater oder Mutter zu sein, und sprechen darüber, dass die menschliche Spezies sich ursprünglich in einer Umgebung entwickelte, in der die Gemeinschaft Eltern bei dieser Aufgabe stärker unterstützte. Dies kann Eltern helfen, den Stress zu erkennen, unter dem sie stehen, und ihn mit Selbstmitgefühl zu akzeptieren. Es ermutigt sie außerdem, ihren eigenen Bedürfnissen mehr Raum zu geben, indem sie sich die Frage stellen: „Was brauche ich?“ statt: „Was stimmt nicht mit mir?“ Wir können beginnen, die Ausgewogenheit unserer Lebensbereiche zu überprüfen und uns zu fragen, wie wir besser für uns selbst sorgen und zusätzliche Ressourcen und Unterstützung mobilisieren können.
2.2.2.3 Die Evolution der geteilten Fürsorge
Wie und warum entwickelte sich das System der gemeinsamen Aufzucht, und was bedeutet das für unser Elternsein, für die kindliche Entwicklung und für die menschliche Natur? Diese und andere Fragen stellte sich Sarah Hrdy in ihrer Untersuchung über die evolutionären Grundlagen der Mutter- und Elternschaft. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, beginnt Hrdy mit einer weiteren Frage: Wie war eine Entwicklung möglich, die dazu geführt hat, dass unsere Spezies Nachkommen mit derartig großen Gehirnen hervorbringt, die nach ihrer Geburt vollständig von elterlicher Fürsorge abhängig sind und so langsam heranwachsen, dass sie viele Jahre lang von ihren Eltern ernährt und umsorgt werden müssen? Die Beantwortung dieser Frage wird noch schwieriger, wenn man berücksichtigt, dass der Grad der Einbeziehung von Vätern in die Kinderaufzucht zwar beim Menschen höher war als bei den meisten anderen Primaten, aber im Laufe der Evolution bis hin zur Gegenwart extrem schwankte (Hrdy 2009).
Hrdy geht davon aus, dass Mütter bei der Aufzucht ihrer Kinder immer schon auf Hilfe angewiesen waren, denn dies war die einzige Möglichkeit, um in der Phase der Evolution, in der der moderne Mensch sich entwickelte, langsam heranreifende, investitionsintensive und abhängige Nachkommen bis ins Erwachsenenalter durchzubringen. Menschenkinder benötigen enorm viele Kalorien und sehr viel Fürsorge, um zu überleben und heranzureifen – sehr viel mehr als die Nachkommen unserer nächsten Verwandten aus dem Reich der Affen. Dennoch folgen die Geburten bei menschlichen Müttern in kürzeren Abständen aufeinander als bei Menschenaffenmüttern (heutige Jäger-Sammler-Mütter bringen ungefähr alle drei bis vier Jahre ein Kind zur Welt, während Menschenaffenmütter in Intervallen von etwa sechs Jahren gebären). Wie also war es möglich, dass Menschen sich trotz der hohen „Kosten“ der Kinderaufzucht erfolgreicher vermehrten als andere Große Menschenaffen? Hrdys Antwort ist simpel: Sie hatten genügend Helfer. Die These von der kooperativen Aufzucht könnte erklären, weshalb unsere Vorfahren in der Lage waren, sich zahlreicher zu vermehren als ihre Menschenaffenverwandten und die Welt zu bevölkern (Hrdy 2009).
2.2.2.4 Wer half den Müttern, ihre Kinder aufzuziehen?
Wenn unsere Vorfahren also Hilfe benötigten, um ihre kostspieligen und lange von ihnen abhängigen Jungen aufzuziehen, wer half ihnen dann? Eine Antwort lautet: die Väter, und tatsächlich engagieren sich Menschenväter, verglichen mit den Vätern der meisten anderen Säugetiere und Primaten, ungewöhnlich stark. Dennoch ist die Schwankungsbreite der väterlichen Beteiligung an der Kinderaufzucht bei den bislang untersuchten menschlichen Populationen extrem hoch: An einem Ende des Spektrums stehen Väter, die nach der Befruchtung keinerlei Kontakt zu ihren Nachkommen haben, am anderen die stark involvierten Väter einiger Jäger-Sammler-Gesellschaften und die „Hausmänner“ in westlichen Industriegesellschaften (Hrdy 2009; Hewlett 2004; Konner 2010). Das heißt nicht, dass Väter nicht wichtig wären – das sind und waren sie auch aus evolutionärer Perspektive. Rätselhaft bleibt jedoch, wie es unseren Vorfahren gelingen konnte, sich so viel erfolgreicher zu vermehren als andere Primaten und sich unter den unterschiedlichsten Umweltbedingungen überall auf der Erde anzusiedeln, wenn die Mütter ihren Nachwuchs nicht allein aufziehen und auch nicht zuverlässig auf die Hilfe der Väter setzen konnten.
Читать дальше