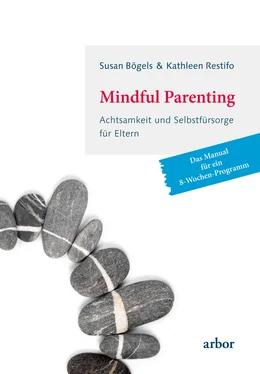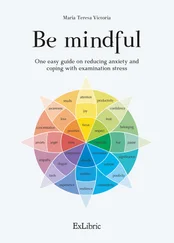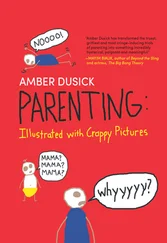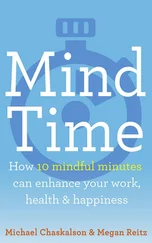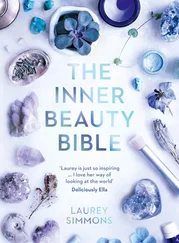Paul Gilberts Modell der drei Affektregulationssysteme – das Bedrohungs- und Selbstschutzsystem, das anreiz- und belohnungssuchende Antriebserregungssystem und das Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem – ermöglicht es uns, unsere automatischen elterlichen Reaktionen in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Gilbert beschreibt, wie sich diese drei Systeme gemeinsam entwickelten, um das menschliche Gefühlsleben und Verhalten zu regulieren. Das Antriebserregungssystem motiviert uns, nach Belohnungen, Ressourcen, Partnern und Erfolgen zu streben, und ist mit Lustgefühlen verbunden. Doch bei vielen von uns ist dieses System überaktiv. Ständig wollen wir etwas tun, haben und erreichen, und wenn wir einmal nichts tun, fühlen wir uns leer und erschöpft oder verurteilen uns selbst. Unser Bedrohungsund Selbstschutzsystem ist ebenfalls überaktiv, wird heute allerdings eher durch zwischenmenschliche Konflikte ausgelöst als durch echte Bedrohungen für Leib und Leben. Gilbert zufolge interagiert unser Antriebserregungssystem mit unserem Bedrohungs- und Selbstschutzsystem. So streben wir vielleicht nach Erfolgen und Zielen, um Unterlegenheitsgefühle oder Ablehnung durch andere zu vermeiden, oder wir glauben, dass wir etwas Bestimmtes tun „sollten“, um zu vermeiden, dass wir Scham oder Schuldgefühle empfinden oder uns schlecht fühlen. Das dritte System in diesem Modell, das der Besänftigung und Zufriedenheit, hat sich aus dem Bindungssystem entwickelt. Während das Antriebserregungssystem mit aufgeladenen, aufgeregten, lustvollen Gefühlen assoziiert ist, ist das Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem durch Gefühle der Ruhe, Zufriedenheit, Friedlichkeit und Sicherheit gekennzeichnet (Gilbert 2009). Oxytozin, ein Hormon, das während des Stillens, beim Liebesakt und anderen Bindungserfahrungen ausgeschüttet wird, ist mit diesem System assoziiert. Oxytozin ist auch an der Beruhigung des autonomen Nervensystems nach einer mit Stress verbundenen Erfahrung beteiligt und hilft uns, in Stressphasen enge emotionale Bindungen aufzubauen (Carter 1998). Durch unseren modernen Lebensstil wird dieses System oft unzureichend stimuliert.
2.2.3.1 Schlussfolgerungen für heutige Eltern
Wie Gilbert hervorhebt, haben sich diese Systeme entwickelt, um uns beim Überleben zu helfen, und wir brauchen alle drei noch immer. Doch wenn diese Systeme aus dem Gleichgewicht geraten, leiden wir. Wenn unser Antriebserregungssystem zu stark wird, sind wir zu oft im Aktions-Modus; wenn unser Bedrohungs- und Selbstschutzsystem überaktiv ist, sind unsere Reaktionen von Angst und Feindseligkeit geprägt. Unser Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem, das unser Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen unterstützt und uns dazu befähigt, uns ruhig, zufrieden und getröstet zu fühlen, ist in westlichen Industriegesellschaften häufig unterrepräsentiert (Gilbert 2009). Dies kann dazu führen, dass wir uns von unserem Leistungsstreben und unseren automatischen Stressreaktionen getrieben fühlen. Doch die Forschung liefert immer mehr Hinweise darauf, dass sichere Bindungen nicht nur psychologische Gewinne wie Gefühle der Sicherheit und des Vertrauens mit sich bringen, sondern auch in physiologischer und neurochemischer Hinsicht von Vorteil sind (Carter 1998).
2.2.3.2 Wie kann Achtsamkeit helfen?
Die Achtsamkeitspraxis zielt nicht auf die Beseitigung eines dieser Systeme ab, sondern auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen ihnen. Durch Achtsamkeit lernen wir, unserer Erfahrung gewahr zu sein, zu bemerken, dass wir im Aktions-Modus sind oder dass wir furchtsam und feindselig reagieren. Wir lernen, diese Erfahrungen als Teil unserer menschlichen Natur zu akzeptieren, statt sie abzulehnen oder uns selbst für solche Reaktionen zu kritisieren. Wir können mitfühlender mit uns umgehen, wenn wir unsere Reaktionen im Kontext unseres evolutionären Erbes sehen können. Wir können die Absicht entwickeln, anders auf unsere automatischen Reaktionen zu antworten, indem wir innehalten und den Dingen einfach erlauben, so zu sein, wie sie sind.
Mit Hilfe der Achtsamkeitspraxis schalten wir vom Aktions-Modus in den Seins-Modus und dämpfen so die hektische Aktivität unseres Antriebserregungssystems und unseres Bedrohungs- und Selbstschutzsystems. Wir stärken außerdem unser natürliches Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem, um die negativen Auswirkungen der beiden anderen Systeme zu reduzieren und mehr positive Gefühle der Ruhe und Zufriedenheit zu erleben. Wenn wir z. B. einfach Zeit mit unseren Kindern verbringen und mit unserer ganzen Aufmerksamkeit präsent sind, statt das Gefühl zu haben, etwas erreichen zu müssen, kann uns das helfen, unser Besänftigungs- und Zufriedenheitssystem zu aktivieren und eine stärkere Bindung an unsere Kinder zu entwickeln. Auch Meditationspraktiken zur Kultivierung von Mitgefühl stärken dieses System, dämpfen die Aktivität des Bedrohungs- und Selbstschutzsystems und führen zu mehr Gleichgewicht. Es gibt immer mehr Forschungsresultate, die belegen, dass Achtsamkeits- und Mitgefühlsmeditation Veränderungen der Gehirnaktivität bewirken, die mit positiven emotionalen Zuständen assoziiert sind (Davidson & Begley 2012).
2.2.2.3 Reaktives Elternverhalten aus evolutionsbiologischer Perspektive: unser Bedrohungs- und Selbstschutzsystem
Aus unserer eigenen Erfahrung als Eltern und aus unseren Elterngruppen wissen wir, dass wir besonders gegenüber unseren Kindern und unseren Partnern zu starken, manchmal sogar explosiven emotionalen Reaktionen neigen. Warum sollten wir uns zu einer Spezies entwickelt haben, die mit höherer Wahrscheinlichkeit genau in den Situationen „ausrastet“, in denen dies am meisten Schaden anrichten kann – im Zusammensein mit unseren Kindern oder anderen Menschen, die wir lieben? Aus der Perspektive der Evolution betrachtet, könnte sich elterliche Reaktivität deshalb entwickelt haben, weil sie höhere kortikale Funktionen gewissermaßen kurzschließt und so kostbare Sekunden spart, die in Situationen, in denen es für unsere Vorfahren um Leben und Tod ging, entscheidend sein konnten. Bei drohender Gefahr dürfte sofortiges Reagieren ohne Nachdenken die Strategie gewesen sein, die am erfolgreichsten war und deshalb mit der Zeit selektiert wurde.
Wenn wir Angst vom evolutionsbiologischen Standpunkt aus betrachten, wird schnell begreiflich, dass reaktives, ängstliches oder überbehütendes Elternverhalten unseren Vorfahren im Pleistozän geholfen hat zu überleben. Wie Joseph LeDoux Forschung zu den Gehirnmechanismen, die der Angst zugrunde liegen, zeigen, haben wir uns zu wirklich guten Gefahrendetektoren entwickelt. Einfach ausgedrückt: In der Umwelt unserer Vorfahren war es durchaus von Vorteil, ein bisschen paranoid zu sein. Individuen, die über ein Gehirn verfügten, das potentielle Gefahren rasch identifizieren und automatisch auf sie reagieren konnte, hatten bessere Chancen, zu überleben und Nachkommen zu zeugen. LeDoux verdeutlicht dies am Beispiel eines Wanderers, der einen auf dem Weg liegenden Stock für eine Schlange hält und automatisch reagiert, indem er zur Seite springt. Diese sogenannte „Low-Road“-Reaktion – eine schnelle, automatische Reaktion auf wahrgenommene Gefahr, die unter Umgehung höherer kortikaler Funktionen direkt vom limbischen System ausgelöst wird – war zu einer Zeit, in der wir unter Raubtieren lebten, sicherlich vorteilhaft. Unser moderner Wanderer wird nach seiner anfänglichen Schockreaktion sicher ein bisschen verlegen über seine Fehlinterpretation lachen, doch unseren Vorfahren verschaffte die Fähigkeit, bei Gefahr sofort zu handeln und später zu denken, einen wichtigen Vorteil im Überlebenskampf (LeDoux 1996). „Vorsicht ist besser als Nachsicht“, nennt Paul Gilbert diese Arbeitsweise unseres Gehirns, die dazu führen kann, dass wir eine Gefahr falsch einschätzen (P. Gilbert, persönl. Kommunikation, 23. Juni 2012). Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie verletzlich und gefährdet Säuglinge und Kinder sind, wird uns klar, dass eine Mutter, die sich „überbehütend“ und „ängstlich“ verhielt, mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebende Nachkommen hatte, die genau diese Merkmale dann weitergaben.
Читать дальше