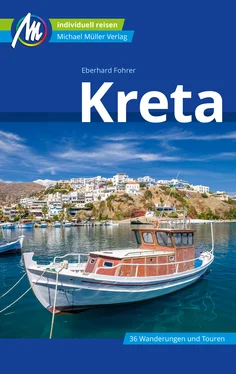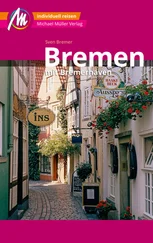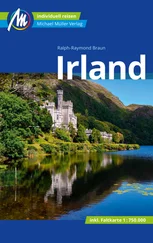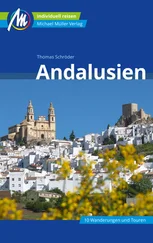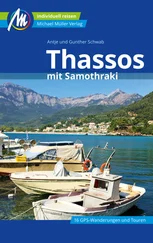Der monumentale Südeingang des Palastes
Weitere spektakuläre Funde folgen - das große Treppenhaus im Ostflügel, anschließend die weiträumigen Königssuiten, der gepflasterte Zentralhof und immer wieder prächtige Fresken. Vor allem aber stoßen Evans und seine Mitarbeiter ständig auf Stierabbildungen auf Fresken, auf Siegelsteinen, als Skulpturen. Am bedeutendsten ist das großartige Stierspringer-Fresko, das einen jungen Mann beim Salto über einen anstürmenden Stier zeigt (Arch. Museum von Iráklion). Der rätselhafte Stierkult rückt damit in den Mittelpunkt des Interesses. Waren diese todesmutigen Springer vielleicht die athenischen jungen Männer und Frauen, die dem Minotaúros jedes Jahr zum Fraß vorgeworfen wurden? Oder waren es Akrobaten, die hier zirkusähnliche Schauspiele vor versammeltem Hofstaat vorführten? Hing der Stiermythos mit den häufigen Erdbeben der Region zusammen, versuchten die Minoer mit den Spielen, die unterirdische Gottheit, die Erdmutter, zu besänftigen? Fragen über Fragen, die bis heute nicht geklärt sind ...
Allmählich erkennt Evans, was hier auf ihn wartet, nämlich die vollständige Ausgrabung und Rekonstruktion eines der bedeutendsten Paläste der Frühgeschichte. Dazu kommen die Registrierung der Funde sowie die Erforschung und Datierung der bisher fast unbekannten minoischen Kultur. Über 30 Jahre verbringt Evans mit diesen gewaltigen Aufgaben - und verwendet einen Gutteil seines Vermögens dafür. Ob archäologische Gesellschaften oder der englische Staat so viel Mittel und Enthusiasmus aufgebracht hätten, mag bezweifelt werden. Architektonisch entpuppt sich der Palast als Juwel, denn über 1200 Räume legen Evans und seine Leute im Lauf der Jahre frei. Ein Höhepunkt wird die Entdeckung des schon erwähnten großartigen Treppenhauses, das zu den Königsgemächern hinunterführt.
Aber mit der Freilegung der Mauern, die Jahrtausende unter Erdmassen verborgen waren, kommen erst die eigentlichen Probleme. Zur Konstruktion des Palastes von Minos war nämlich viel Holz verwendet worden. Schwere Balken hatten große Mauermassen getragen, teilweise dem heutigen Fachwerk ähnlich. Dazu kamen die zahllosen Säulen, die ebenfalls aus Holz waren - Zypressenstämme, mit der Wurzel nach oben, nach unten sich verjüngend. Alle diese Holzteile waren im Feuersturm von 1450 v. Chr. verbrannt worden. Die spärlichen Reste waren durch Feuchtigkeit und Luft längst verfault. Kurz, der ganze Bau drohte zusammenzustürzen und die zahllosen Wunder der Minoer unter sich zu begraben.
Evans und sein Architekt versuchen alles - erst nehmen sie hölzerne Pfosten und Balken, aber diese verfaulen viel zu schnell. Dann versuchen sie es mit Backsteinmauern und sorgfältig eingepassten Steinsäulen - aber das wiederum ist zu teuer (sogar für Evans). In den 20er Jahren wird schließlich der Stahlbeton erfunden - er ist dauerhaft und stark und man kann ihn problemlos in alle Fugen und Hohlräume einfüllen. Er scheint das ideale Restaurierungsmittel zu sein. So ersetzen die Ausgräber alle ehemaligen Holzteile durch Beton und bemalen ihn noch dazu hellbraun, um das Holz zu imitieren. An vielen Stellen im Palast sieht man noch heute diese Betonfassungen.
Am schwierigsten wird die Rettung des großen Treppenhauses. Um den drohenden Zusammensturz zu vermeiden, müssen die unteren Stockwerke mit soliden Betonfundamenten abgestützt werden, dazu muss noch eine ganze Wand aus der Schräglage wieder in die Senkrechte gerückt werden.
Aber Evans will mehr: eine anschauliche, für das Auge interessante Rekonstruktion der ganzen Anlage. Keinen Trümmerhaufen, sondern das schaffen, was man sonst mit Fantasie dazudenken muss. So geht er daran, die Räume wieder mit Decken zu versehen, er lässt auf Grund der Originalfragmente großflächige Wandgemälde mit leuchtenden Farben herstellen, lässt die Schäfte der eingefügten Betonsäulen rot, die Kapitelle und Sockel schwarz bemalen u. Ä. Das „Disneyland für Archäologen“, wie es Spötter gerne nennen, nimmt seinen Anfang ...
Der Palast
Knossós liegt auf einer kleinen Anhöhe im weiten Tal des Kaíratos, gleich links neben der Straße, wenn man von Iráklion kommt. Vorbei an Tavernen und Souvenirshops gelangt man zum Eingang der Anlage, die man von der Westfront her betritt. Ein dichter Gürtel von Aleppokiefern versperrt den Blick auf den Palast, der mit 22.000 m 2Gesamtfläche, weit über tausend Räumen und bis zu vier Stockwerken bei weitem der größte der minoischen Paläste auf Kreta war. Völlig unbefestigt steht er da, ein Symbol für die allen Anzeichen nach gänzlich ungefährdete Stellung der Minoer - ihre Schiffe beherrschten das gesamte östliche Mittelmeer, Mauern hatten sie nicht nötig, so wird heute vermutet.
Das Grundschema des Aufbaus ist bei allen kretischen Palästen gleich: Um einen lang gestreckten, rechteckigen Zentralhof gruppieren sich die Gebäudeflügel im Viereck. In Knossós befinden sich an der westlichen Längsseite die Kulträume und Magazine, an der Rückfront (Ostseite) das große Treppenhaus, die Privaträume der Königsfamilie und Werkstätten. Fenster gibt es nur wenige, dafür wunderbar konstruierte Lichtschächte, die Luft und Sonnenlicht bis in die entlegensten Winkel des Palastes schicken - die ureigenste Erfindung der Minoer. Höchst eindrucksvoll ist auch die Kanalisation, deren modern anmutende Tonröhren und Abflussschächte man überall im Palast entdeckt.

Rekonstruktionen minoischer Fresken über dem Thronsaal
Anfahrt/Verbindungen Mit dem eigenen Fahrzeug nimmt man ab Eleftherias-Platz den breiten Leoforos Dimokratias, der direkt nach Knossós führt (etwa 6 km). Direkt am Eingang zum Palast gibt es einen großen, kostenlosen Parkplatz, eingerichtet von der Stadt Iráklion. Bereits etwa 100 m vorher wird man von der Taverne Pasiphae zum Parken in einem schattigen Olivenhain gewunken. Auch hier ist das Parken kostenlos, der Besuch der Taverne wird nicht eingefordert.
Bus 2 fährt in Iráklion von der ehemaligen Busstation am Hafen etwa alle 20 Min., er hält außerdem am Eleftherias-Platz und am Jesus-Tor. Fahrpreis einfach etwa 1,70 €, bei Kauf im Bus 2,50 €, Dauer der Fahrt im Stop-&-Go-Verkehr bis zu 45 Min.
Taxi kostet etwa 12 €.
Öffnungszeiten April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr, übrige Zeit Mo-Fr ca. 8-17, Sa/So 8.30-15 Uhr. Eintritt ca. 15 € (Nov. bis März 8 €), Senioren über 65 J. sowie Schül./Stud. und Pers. von 6-25 J. aus Nicht-EU-Ländern 6 €, freier Eintritt für Pers. bis 25 J. und Schül./Stud. aus EU-Ländern. Fotografieren und Video frei. Tel. 2810-231940.
Kombiticket mit Arch. Museum ca. 20 €, drei Tage gültig, für Schül./Stud. aus Nicht-EU-Ländern 10 € (im Winter 12 €/6 €).
Online-Ticket unter etickets.tap.gr
Freier Eintritt Nov. bis März am ersten So im Monat, außerdem 6. März, 18. April, 18. Mai, European Cultural Heritage Day (letzte Sept.-Woche) und 28. Okt.
Читать дальше